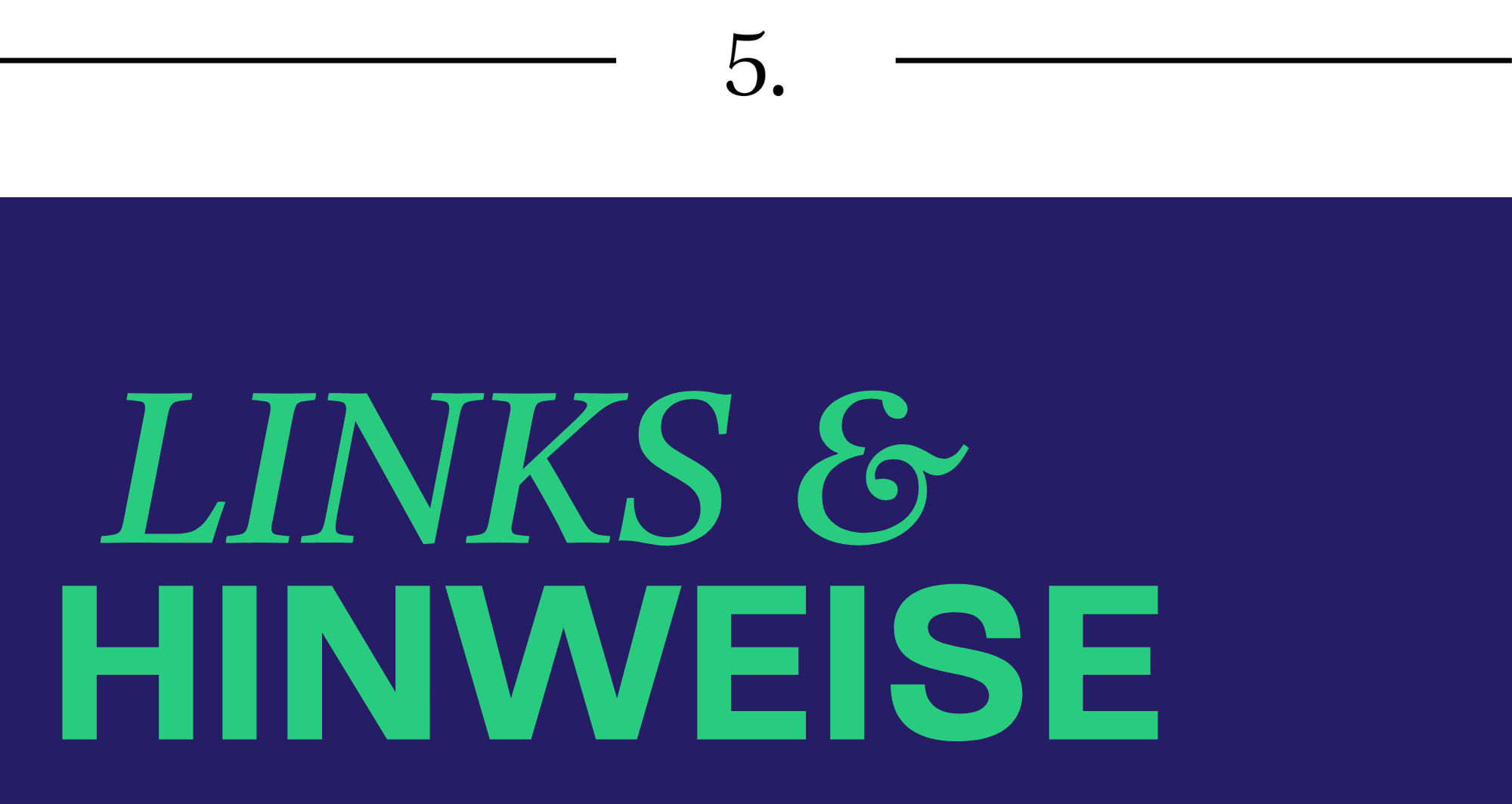16.00 Uhr
Konzerthausorchester Berlin, RIAS Kammerchor, Joana Mallwitz


BENJAMIN BRITTEN (1913 – 1976)
„Four Sea Interludes“ aus der Oper „Peter Grimes“ op. 33a
„Dawn“ (Dämmerung). Lento etranqillo – (attacca)
„Sunday Morning“ (Sonntagmorgen). Allegro spirituoso – (attacca)
„Moonlight“ (Mondschein). Andante comodo e rubato – (attacca)
„Storm“ (Sturm). Presto con fuoco
DONNACHA DENNEHY (* 1970)
Konzert für Violine und Orchester (Deutsche Erstaufführung)
Vital, atmospheric and volatil
Tranquil and spacious
Viertel = 112
PAUSE
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)
Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92
Poco sostenuto – Vivace
Allegretto
Presto – Assai meno presto
Allegro con brio
Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur mitgeschnitten und am 12.09. um 20.03 Uhr ausgestrahlt.

Musik eines britischen und eines irischen Komponisten wird im ersten Konzertteil kombiniert. Für beide ist die Landschaft, aus der sie stammen, durchaus prägend gewesen. Donnacha Dennehy deutet in seinem Werkkommentar an, dass die Musik mancher Passagen seines Violinkonzertes etwas mit seiner Herkunft zu tun haben könnte. Auch Britten waren solche Einflüsse wichtig. Der bekennende Pazifist hatte 1939 seine Heimat verlassen und war gemeinsam mit seinem Partner, dem Tenor Peter Pears, in die Vereinigten Staaten ausgewandert, um dem Kriegsdienst zu entgehen. Noch in den USA wurde Britten auf den wie er selbst aus Suffolk stammenden Dichter Georg Crabbe (1754 – 1832) und dessen Dichtung „The Bourogh“ aufmerksam. Die Lektüre hatte tiefgreifende Folgen: Sie machte Britten bewusst, wie stark seine Bindung an diese Gegend an der englischen Ostküste war. Er entschloss sich zur Rückkehr und machte Crabbes Dichtung zur Grundlage seiner ersten Oper. Brittens „Peter Grimes“ entstand, während der Zweite Weltkrieg tobte. Wenngleich die Oper kein politisches Werk ist oder direkt auf die Zeitereignisse Bezug nimmt, beleuchtet sie, wohin die Ausgrenzung von Menschen führen kann und verdeutlicht ebenso, wozu eine verblendete und aufgeputschte Masse fähig ist. Ebenso wie Brittens Oper entstand auch Beethovens Siebente Sinfonie in kriegerischen Zeiten, nämlich als Napoleon versuchte, Europa unter seine Herrschaft zu zwingen. Diese Zeitumstände spielen in die Uraufführungs- und auch spätere Rezeptionsgeschichte der Sinfonie hinein.

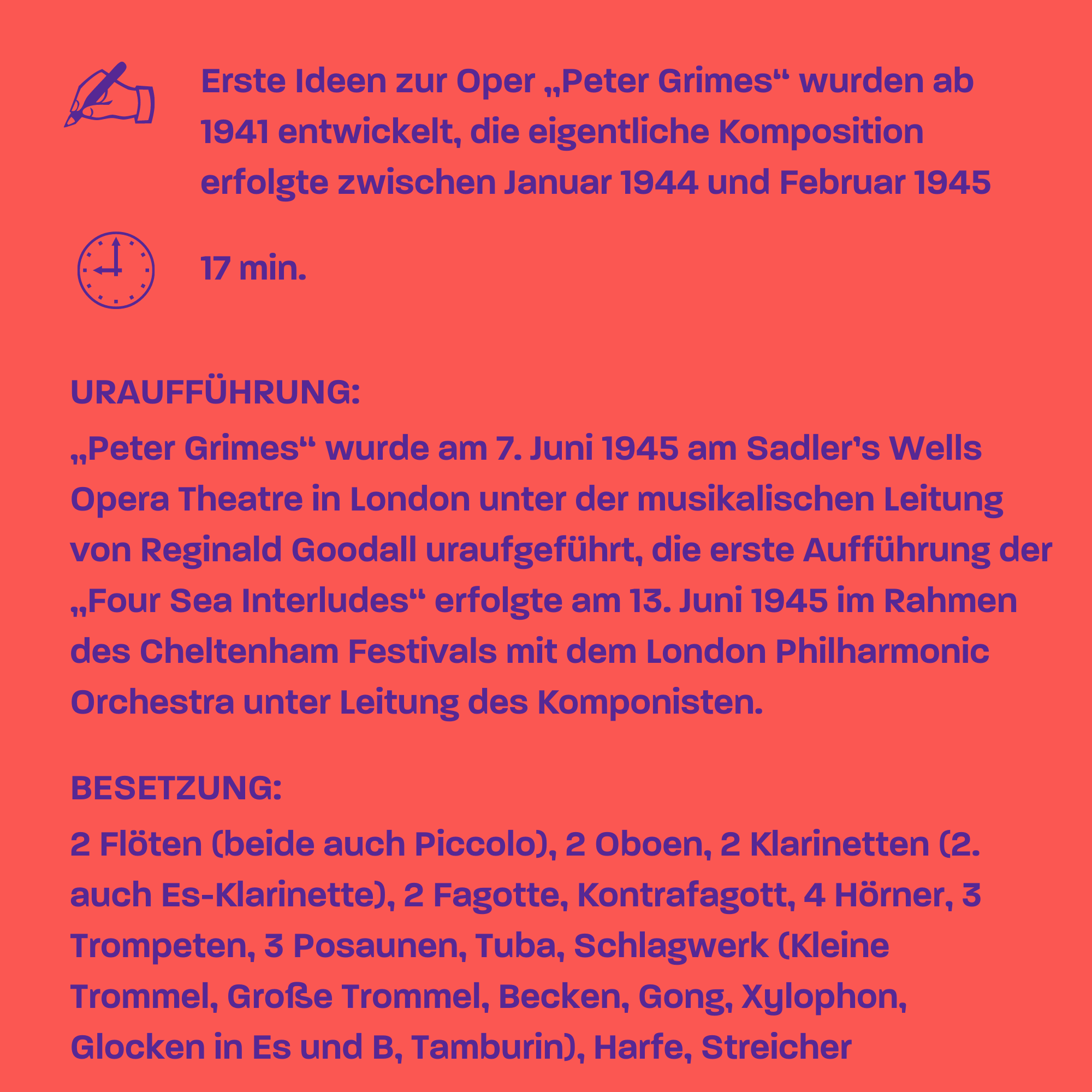
In Brittens „Peter Grimes“ wird die Geschichte des gleichnamigen Fischers erzählt, eines rauen, unangepassten Außenseiters, dem von der hasserfüllten Dorfgemeinschaft keine Chance zur Integration gewährt wird, sondern der – zu Unrecht als Mörder abgestempelt – in den Tod getrieben wird. Schauplatz ist ein Dorf in genau jener Gegend, aus der Britten stammte: „Das Haus meiner Eltern in Lowestoft blickte direkt auf die See, und zu den Erlebnissen meiner Kindheit gehörten die wilden Stürme, die oftmals Schiffe an unsere Küste warfen und ganze Strecken der benachbarten Klippen wegrissen. Als ich ‚Peter Grimes‘ schrieb, ging es mir darum, meinem Wissen um den ewigen Kampf der Männer und Frauen, die ihr Leben, ihren Lebensunterhalt dem Meer abtrotzen, Ausdruck zu verleihen (…).“ Die „Four Sea Interludes“, deren Auskopplung aus der Oper offenbar von vornherein intendiert war, entsprechen vier der insgesamt sechs „Interludes“, die Britten in der Oper zwischen einzelnen Szenen bzw. am Beginn der Akte eingefügt hatte. Die poetisierenden Titel hat Britten den „Interludes“ erst für die konzertante Fassung gegeben, in der sie in anderer Reihenfolge erscheinen als in der Oper. Jenseits ihrer dramaturgischen Funktion im Musiktheater gewinnen sie gleichsam sinfonisches Eigenleben. Die „Sturm“-Musik, die eigentlich im ersten Akt erscheint, wird hier zum dramatischen Finale, in dem sich die in den drei vorangegangenen „Interludes“ untergründig aufbauenden Spannungen entladen. Die See, auf die der Titel des Werkes anspielt, wird zur Metapher menschlicher Existenz: „Das Meer, zumal das stürmische Meer an der ostenglischen Küste, wird zum Inbegriff des Fremden und Beängstigenden, und Britten holt es ins dramatische Geschehen, indem er es in den Orchesterzwischenspielen zwischen den einzelnen Szenen schildert und damit die Grundfarbe des Dunklen und Ausweglosen aufträgt.“ (Thomas Leibnitz)
Britten erreicht in den „Four Sea Interludes“ mit teilweise elementarsten musikalischen Mitteln größte Wirkung. Im ersten „Interlude“ sind das eine aus der Moll-Skala gebildete langsam absinkende Melodie der Violinen und Flöten und stilisierte Wellenbewegungen in simplen Dreiklangsbrechungen, denen düstere Akkordfolgen der Blechbläser antworten. Sie sorgen für jenes latent Bedrohliche, das dieser Musik fast durchweg beigemischt ist.
Das zweite „Interlude“ hat einmal nichts mit dem Meer zu tun, sondern begleitet in der Oper einen sonntäglichen Kirchgang. Die Hörner imitieren in dissonanter Reibung die Kirchenglocken, über deren Klang die Holzbläser mit markanter Motivik eine weitere Ebene etablieren. Eine lyrische Melodie der Bratschen und Celli antwortet, aber wenn die Musik des Beginns wiederkehrt, tönen reale Glocken sekundiert von anderen Instrumenten in tiefer Lage in gespannter Bitonalität massiv hinein und breiten den Schatten des Todes über die Szenerie.
Disparate klangliche Ebenen werden auch im dritten „Interlude“ miteinander verklammert, ohne dass die Spannungen zwischen ihnen aufgelöst würden: einerseits homophone, engschrittige Akkordfolgen in weicher Klanglichkeit, andererseits die grell und spitz gefärbten Einwürfe von Flöte, Harfe und später auch Xylophon.

So wild und ungezügelt sodann die „Sturm“-Musik losbricht, so präzise ist sie geformt, nämlich als Rondo. Zwischen den wiederkehrenden Hauptteilen erhalten Episoden Raum: Die erste wird von sich chromatisch in parallelen Quinten emporwindenden Gestalten der Blechbläser getragen, die tönen wie Sturmgeheul. Die zweite könnte einer Schostakowitsch-Sinfonie entlehnt sein. Die Sprache beider Komponisten ist verwandt, und zwischen beiden entwickelte sich ab den 1960er Jahren eine Freundschaft. Die dritte Episode aber spielt auf eine Passage an, die in der Oper unmittelbar der „Sturm“-Musik vorausgeht und in der Peter Grimes fragt: „Welchem Hafen steure ich zu, weitab von Wetternot, von Sturmflut fern? Welcher Hafen bietet Ruh‘, wird Landung gewähren?“ Am Ende wird er seinen Tod im Meer finden, das Walt Whitman folgendermaßen beschrieb: „Meer, mit dem Salz des Lebens und den ungegrabenen, immer bereiten Gräbern, heulend und hohl in den Stürmen, launische, liebliche See, eines Wesens bin ich mit dir, eines Zustands, und aller Zustände Kenner wie du.“ (Übersetzung: Hans Reiser)
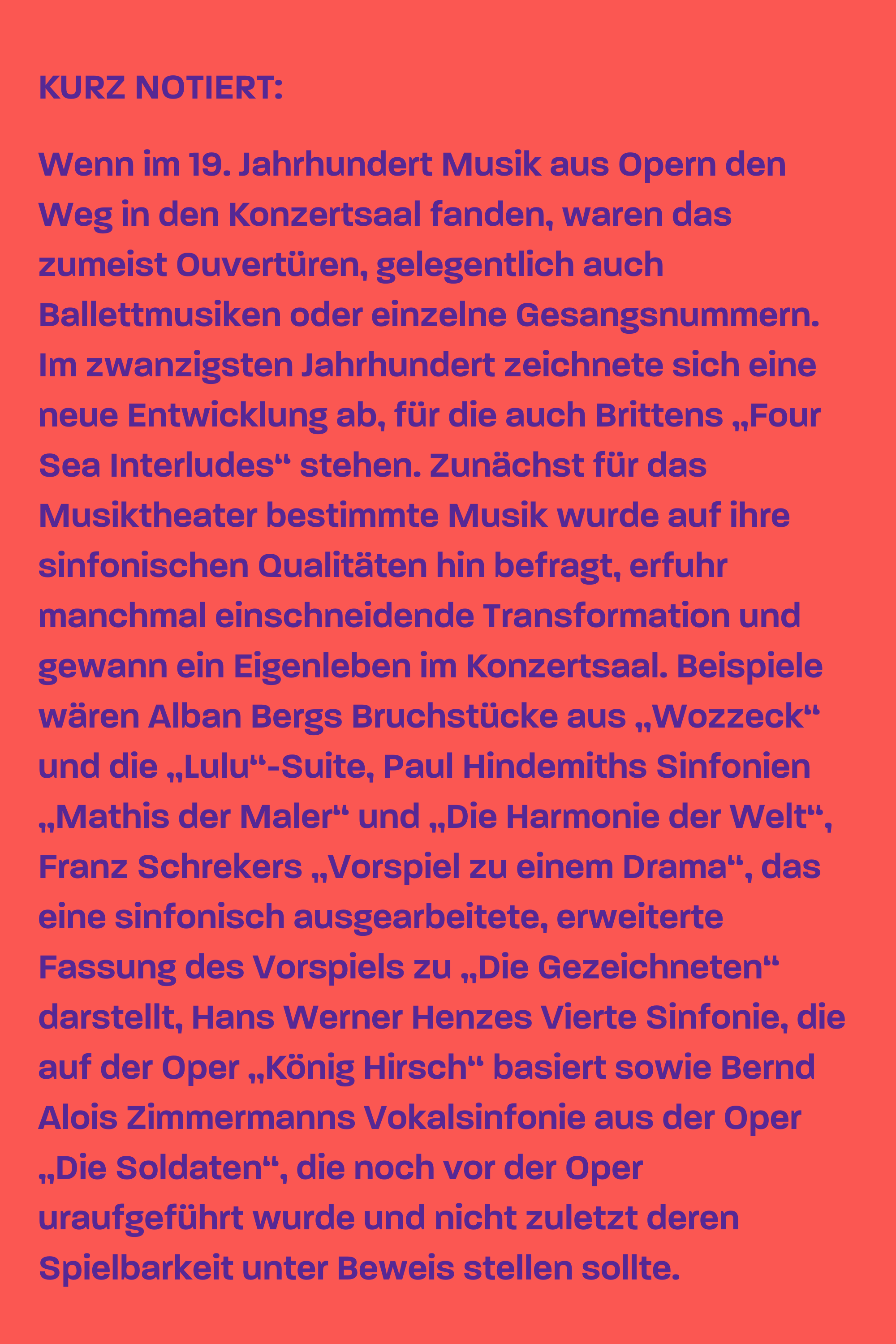

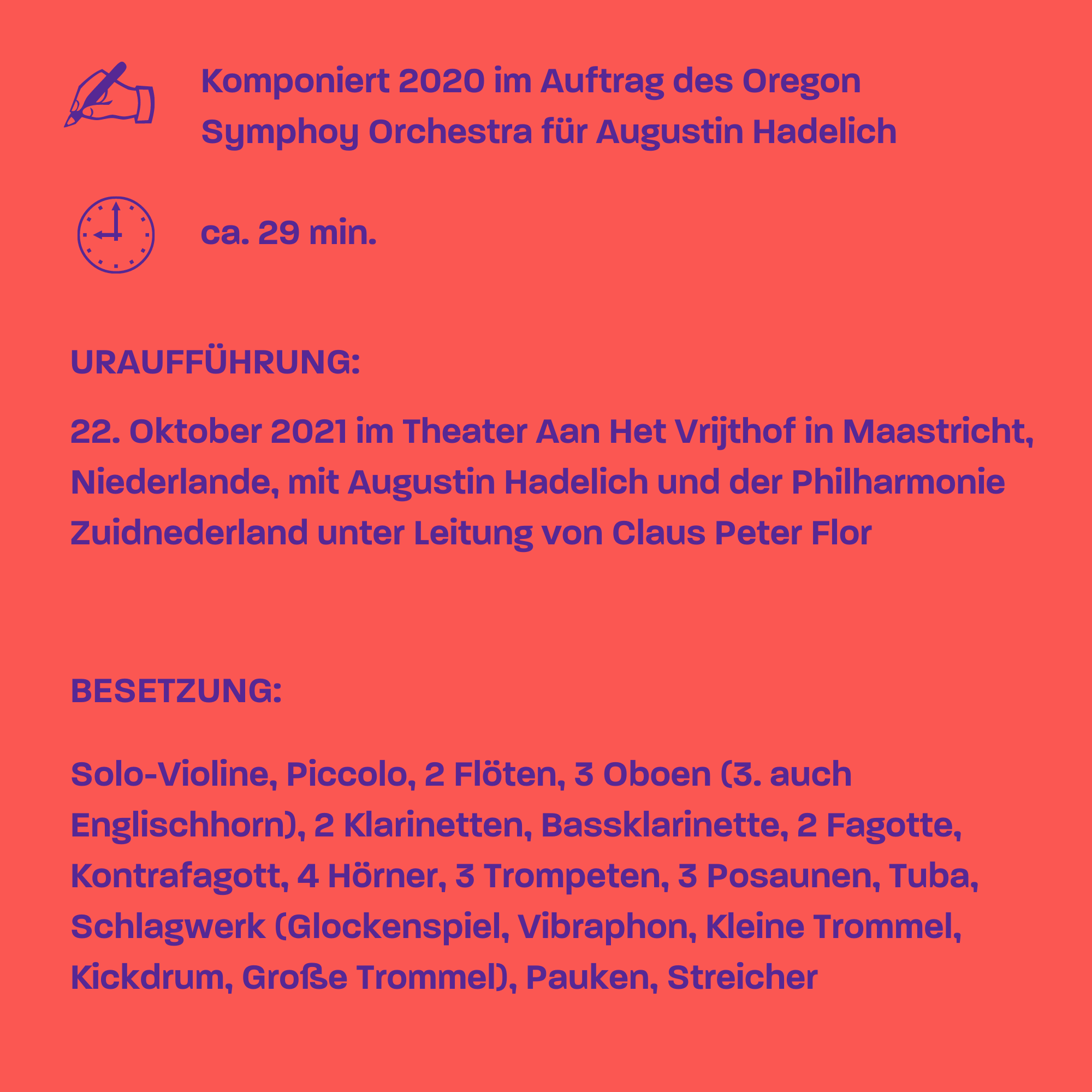
Wenn das Wort „Eklektizismus“ im Deutschen nur nicht so einen negativen Beigeschmack hätte! Eigentlich bezeichnet es mit Blick auf die Kunst nur, dass verschiedene schon vorhandene Stile oder Materialien aufgegriffen und zu etwas Neuem verarbeitet werden, was zunächst einmal nichts über die Qualität des so geschaffenen Werkes aussagt. Wenn also das Wort nicht so einen negativen Beigeschmack hätte, könnte man es nutzen, um Donnacha Dennehys Violinkonzert zu charakterisieren, denn in diesem Werk sind verschiedenste Einflüsse unterschiedlicher Provenienz amalgiert: In der äußeren Form entspricht es dem klassisch-romantischen Modell des dreisätzigen Solo-Konzerts. In den motorisch geprägten Passagen von Kopfsatz und Finale scheint eine gewisse Nähe zur Minimal Music anzuklingen. Manche der rhythmischen Prägungen verweisen auf Strawinsky als Vorbild. Im Finale wird auf irische Folklore angespielt. In der Harmonik hat die Auseinandersetzung mit dem Spektralismus ihre Spuren hinterlassen – jener seit den 1970er Jahren bestehenden kompositorischen Richtung, die von der Analyse der Obertonspektren der Töne ausging und faszinierende Klangwelten jenseits des temperierten Tonsystems erschloss. Solche irisierenden Akkordgebilde begegnen sogleich im ersten Satz: Sie sekundieren den bewegten und höchst virtuosen Figurationen des Solo-Instruments. Diese Konstellation – Figurationen über mikrotonal gefärbten Akkordblöcken – bleibt für den Satz prägend, auch wenn sie streckenweise Modifikationen erfährt und etwa die Motorik des Solisten auf das Orchester übergreift. Der Auf- und Abbau dieser Akkorde suggeriert ein Hinein- und Hinauszoomen, eine Bewegung, die nach den Worten des Komponisten für diesen Satz typisch sei.
Im zweiten Satz entfaltet sich der Gesang des Soloinstruments über einem Netz von eng verwobenen Begleitstimmen, die den Eindruck einer von sanften Wellen bewegten Wasseroberfläche evozieren könnten: „Der zweite Satz hat für mich einen Hauch von Meer. Das Meer taucht in meiner Musik immer wieder auf, so scheint es. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich in Irland aufgewachsen bin, umgeben von Wasser auf allen Seiten“ – so der Komponist. Auf Kontrastsetzungen, auf formale Zäsuren, auf zielgerichtete Steigerungen wird weitgehend verzichtet, so dass sich der Eindruck einer gleichsam aufgehobenen oder kreisenden Zeit ergibt, als sei man allem Irdischen entrückt.
Im Finale dann dominieren zunächst die rhythmischen Impulse, die kräftigen Akzente und erneut die motorische Bewegung, die bald von absteigenden Tonfolgen überlagert wird. Ein Jig – ein Volkstanz, der zunächst auf den gesamten britischen Inseln getanzt wurde, bevor er zum irischen Volkstanz schlechthin wurde – taucht schließlich auf, dessen Varianten mit den motorischen Prägungen kollidieren und das Konzert in den fulminanten Schluss treiben.

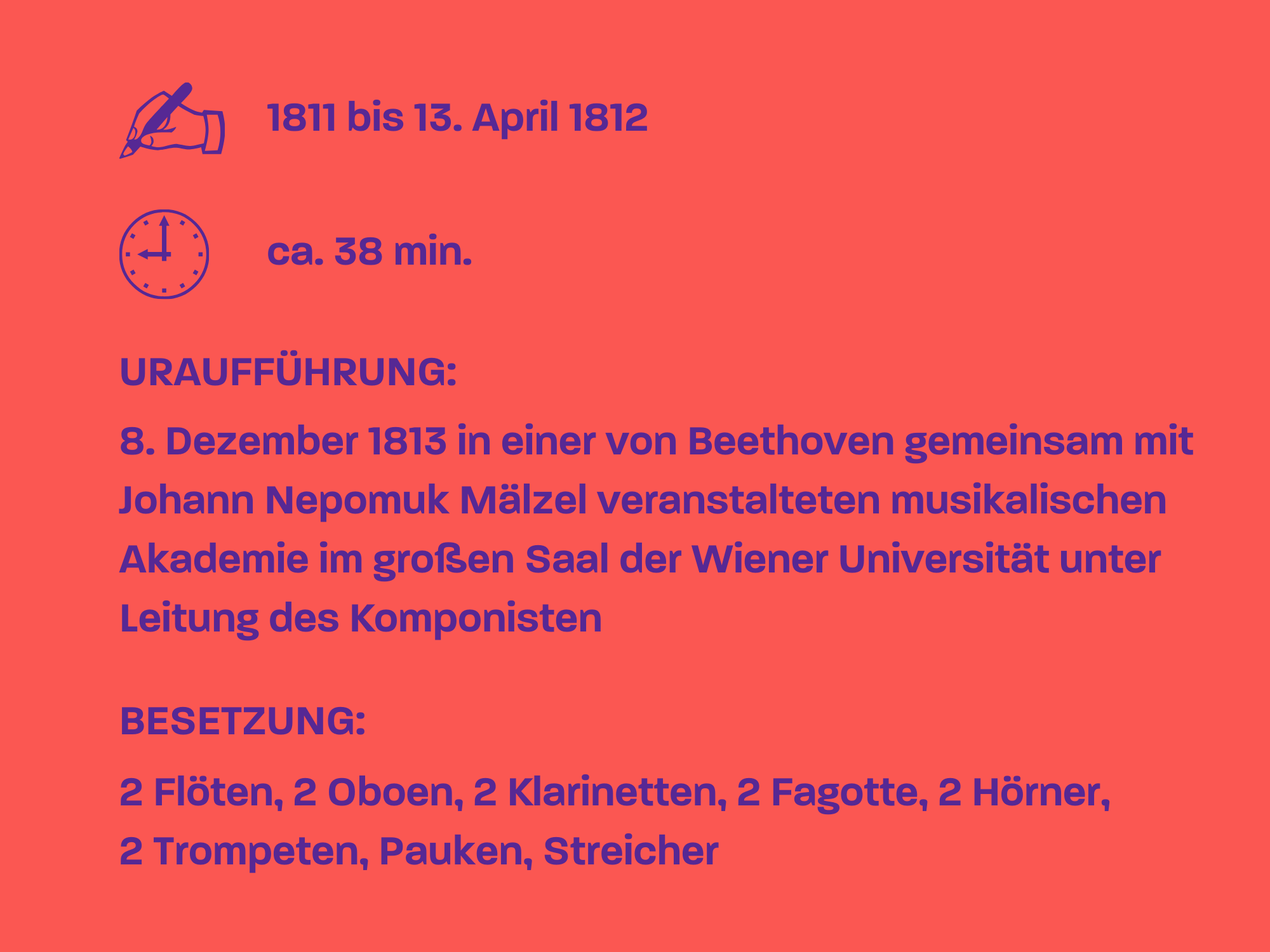
Am 8. Dezember 1813 wurde im großen Saal der Wiener Universität ein denkwürdiges Konzert gegeben (und am 12. Dezember wiederholt). Veranstalter waren der Erfinder und Mechaniker Johann Nepomuk Mälzel (heute würde man sagen als Produzent) und Ludwig van Beethoven als Komponist und musikalischer Leiter. Ein großes und hochqualifiziertes Orchester war versammelt, in dem die Crème de la Crème des Wiener Musiklebens mitwirkte, darunter der Geiger und Beethoven-Freund Ignaz Schuppanzigh, die Komponisten Louis Spohr, Johann Nepomuk Hummel und Antonio Salieri. Eingeleitet wurde das Konzert mit der Uraufführung von Beethovens Siebenter Sinfonie, es schlossen sich zwei Märsche von Johann Ludwig Dussek und Ignaz Pleyel für einen von Mälzel konstruierten mechanischen Feldtrompeter in Begleitung des Orchesters an, und den krönenden Abschluss bildete die Uraufführung von Beethovens „Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria“ op. 91. Gerade in diesem letztgenannten Stück fanden zeitgeschichtliche Ereignisse ihren Niederschlag. Es war die Zeit der antinapoleonischen Befreiungskriege. Die in der Musik geschilderte Schlacht hatte knapp ein halbes Jahr zuvor stattgefunden. Die Völkerschlacht bei Leipzig lag sieben Wochen zurück und die Schlacht bei Hanau hatte fünf Wochen zuvor stattgefunden. Das Konzert war als Benefizveranstaltung für die in der letztgenannten Schlacht invalid gewordenen österreichischen und bayerischen Soldaten geplant. Kein Wunder, dass die Nachwelt die streckenweise von einem ekstatisch rauschhaften Tonfall geprägte Siebente Sinfonie ebenfalls im historischen Kontext der Kämpfe gegen die napoleonischen Truppen als „Siegessinfonie“ zu deuten versuchte. Sie wurde freilich deutlich vor den genannten Ereignissen konzipiert und komponiert. Früheste Skizzen reichen bis ins Jahr 1806 zurück. Die eigentliche Ausarbeitung des Werkes erfolgte von 1811 bis zum Frühjahr 1812.

Der Erfolg jenes Konzertes am 8. Dezember 1813 muss unbeschreiblich gewesen sein. Auch und gerade die Sinfonie fand einhellige Anerkennung und ist seit nun mehr als zweihundert Jahren fester Bestandteil des Repertoires. Ihre buchstäblich überwältigende Wirkung verdankt sie insbesondere einer Eigenart: In keinem anderen Werk hat Beethoven in solchem Maße auf die suggestive Kraft des Rhythmus gesetzt. Ein pulsierender, federnder oder gar stampfender Rhythmus vermag individuelle zu kollektiven Bewegungen zu bündeln, wie das im Tanz geschieht. Aber selbst da, wo solche Musik nicht direkt physisch nachvollzogen wird, sondern ihr nur gelauscht wird wie im Konzertsaal, entfaltet sie einen Sog, empfinden sie die Hörenden als „mitreißend“, suggeriert sie dem, der sich ihr überlässt, in ihr im doppelten Wortsinne aufgehoben zu sein.
Jeder der vier Sätze wird von ganz elementaren rhythmischen Formeln geprägt. Am Übergang von der langsamen Einleitung des ersten Satzes zu dessen Hauptteil erleben wir die Geburt so einer Gestalt, die sodann im federnden 6/8-Takt nahezu unausgesetzt präsent ist. Sie prägt zunächst das von der Flöte vorgetragene Hauptthema, und bald, wenn es in großem Auftakt an das volle Orchester übergeht, „hebt“ die Musik „ab“. Ganz besonders eindringlich geraten freilich jene wenigen Momente – beispielsweise kurz nach Beginn der Reprise – in der die unausgesetzte Bewegung stockt und die Musik wie fragend innehält, um dann doch wieder vom Taumel ergriffen zu werden.
Im zweiten Satz ist es ein Schreitrhythmus, der die Hauptteile prägt. Nach dem strahlenden A-Dur des Kopfsatzes erscheinen dessen Moll-Tonalität und die dunkle klangliche Färbung um so wirkungsvoller. Die Variationen des engschrittigen, akkordischen Themas suggerieren durch das Aufblenden des Klangs und die zunehmende dynamische Intensität gleichsam das Bild einer sich nähernden Prozession. Kontrastpartien sorgen zweimal für Aufhellung und dafür, dass Variations- und Liedform gekreuzt werden.
Im übermütig daherkommenden Scherzo kann man nachvollziehen, wie Beethoven aus winzigsten motivischen Partikeln, die für sich genommen musikalische Nichtigkeiten sind, auf überaus geistvolle Weise Funken schlägt und große Zusammenhänge entstehen lässt. Die ruhige, teilweise einen majestätischen Tonfall etablierende Triopartie kontrastiert zweimal. Wenn sie am Ende ein drittes Mal anzuheben scheint, narrt Beethoven die Hörer und lässt den Satz abrupt enden: „Man sieht den Komponisten ordentlich die Feder wegwerfen“, kommentierte Robert Schumann.
Der Schreitrhythmus des zweiten Satzes mutiert am Beginn des Finales zu zwei knappen Fanfarenstößen und wird dann in das wirbelnde und stampfende Hauptthema integriert, dem Akzentuierungen auf unbetonten Taktzeiten noch einen besonderen Drive verleihen. Das zweite Thema ist nichts anderes als eine verzerrte Variante des Triothemas aus dem Scherzo und man hat tatsächlich den Eindruck, dass – wie Renate Ulm es formulierte – Beethoven den Tanzcharakter seiner Sinfonie „mit Ingrimm“ auf die Spitze treibt.
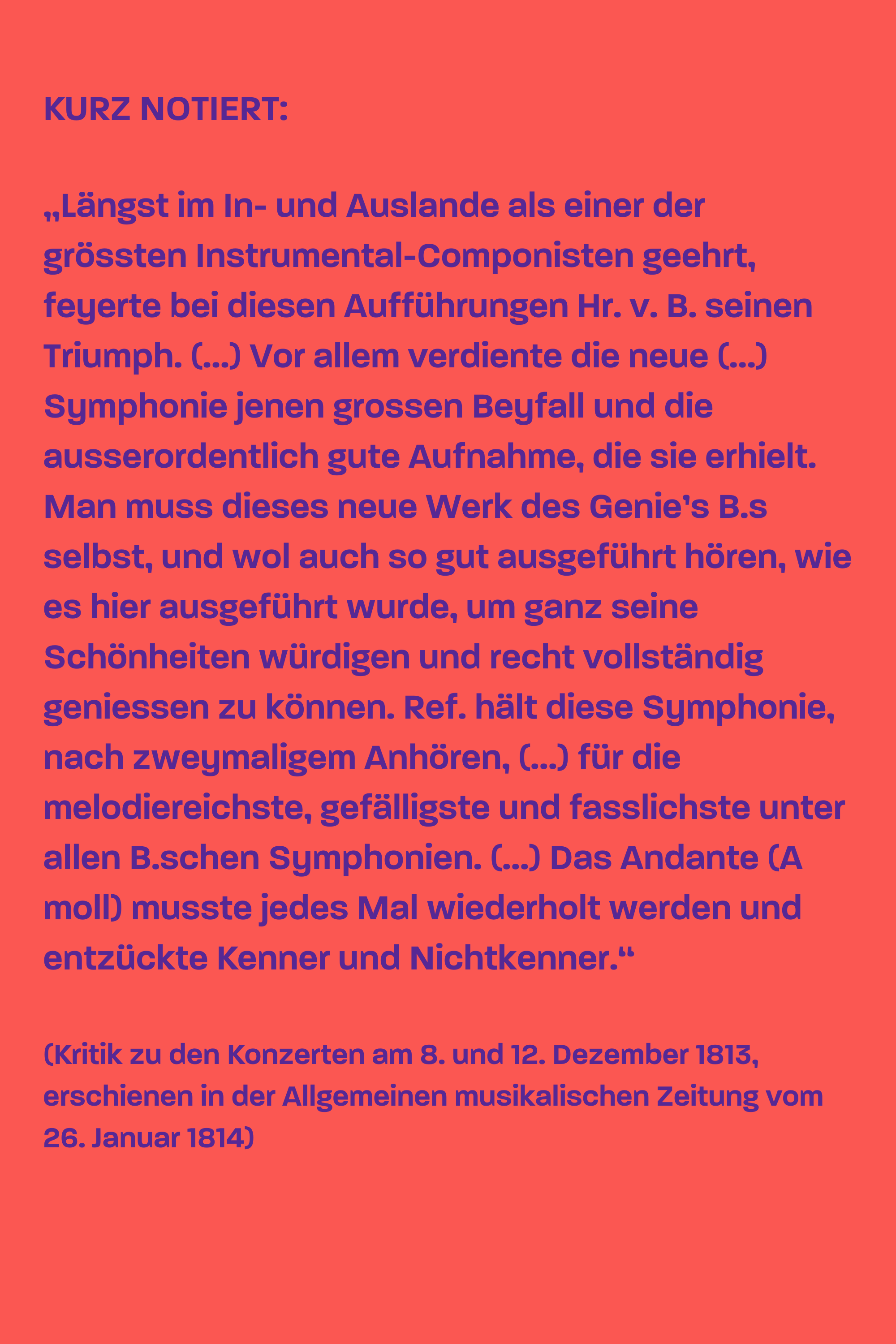



Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz.
Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten inne hatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.
1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.
Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Mit Beginn der Saison 2023/24 ist Joana Mallwitz Chefdirigentin und Künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin.
Spätestens seit ihrem umjubelten Debüt bei den Salzburger Festspielen 2020 mit Mozarts „Cosi fan tutte“ zählt Joana Mallwitz zu den herausragenden Dirigent*innenpersönlichkeiten ihrer Generation. Ab 2018 als Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg tätig, wurde sie 2019 als „Dirigentin des Jahres“ ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren war sie an der Nationale Opera Amsterdam, dem Opera House Covent Garden, an der Bayerischen Staatsoper, der Oper Frankfurt, der Royal Danish Opera, der Norwegischen Nationaloper Oslo und der Oper Zürich zu Gast.
Konzertengagements führten sie zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, HR- und SWR-Sinfonieorchester, den Dresdner Philharmonikern, dem Philharmonia Orchestra London, den Münchner Philharmonikern, dem City of Birmingham Symphony Orchestra, dem Orchestre National de France, dem Orchestre de Paris und den Göteborger Symphonikern und als Porträtkünstlerin zum Wiener Musikverein.
Nach ihrem langjährigen Engagement als Kapellmeisterin am Theater Heidelberg trat Mallwitz zur Spielzeit 2014/2015 als jüngste Generalmusikdirektorin Europas ihr erstes Leitungsamt am Theater Erfurt an. Dort rief sie die Orchester-Akademie des Philharmonischen Orchesters ins Leben unf begründete das Composer in Residence-Programm „Erfurts Neue Noten“. Ihre ebenfalls in dieser Zeit konzipierten „Expeditionskonzerte“ wurden auch am Staatstheater Nürnberg und als Online-Format ein durchschlagender Erfolg.
In Hildesheim geboren, studierte Joana Mallwitz an der Hochschule für Musik und Theater Hannover Dirigieren bei Martin Brauß und Eiji Oue sowie Klavier bei Karl-Heinz Kämmerling und Bernd Goetzke.
Joana Mallwitz ist Trägerin des Bayerischen Verfassungsordens. Sie lebt mit Mann und Sohn in Berlin.

Als Sohn deutscher Eltern in Italien geboren, studierte Augustin Hadelich an der New Yorker Juilliard School und gewann 2006 den Internationalen Violinwettbewerb in Indianapolis. 2009 erhielt er den prestigeträchtigen „Avery Fisher Career Grant“, 2011 eine Fellowship des Borletti-Buitoni Trust. 2015 gewann er den Warner Music Prize, 2016 folgte der Grammy Award. Das Fachmagazin „Musical America“ wählte ihn 2018 zum „Instrumentalist of the Year“. 2021 erhielt er einen Opus Classic für seine Aufnahme von Dvořáks Violinkonzert. Seit 2021 lehrt er an der Yale School of Music. Als Solist auf den Podien von Spitzenorchestern weltweit erfindet er das klassisch-romantische Violinrepertoire dank seines makellosen Spiels und seiner Gestaltungskraft immer wieder aufregend neu. Sein begeistert forschendes Interesse gilt dazu den Violinkonzerten des 20. und 21. Jahrhunderts. Augustin Hadelich spielt auf einer Violine von Giuseppe Guarneri del Gesù von 1744, bekannt als „Leduc, ex Szeryng“, einer Leihgabe des Tarisio Trust.
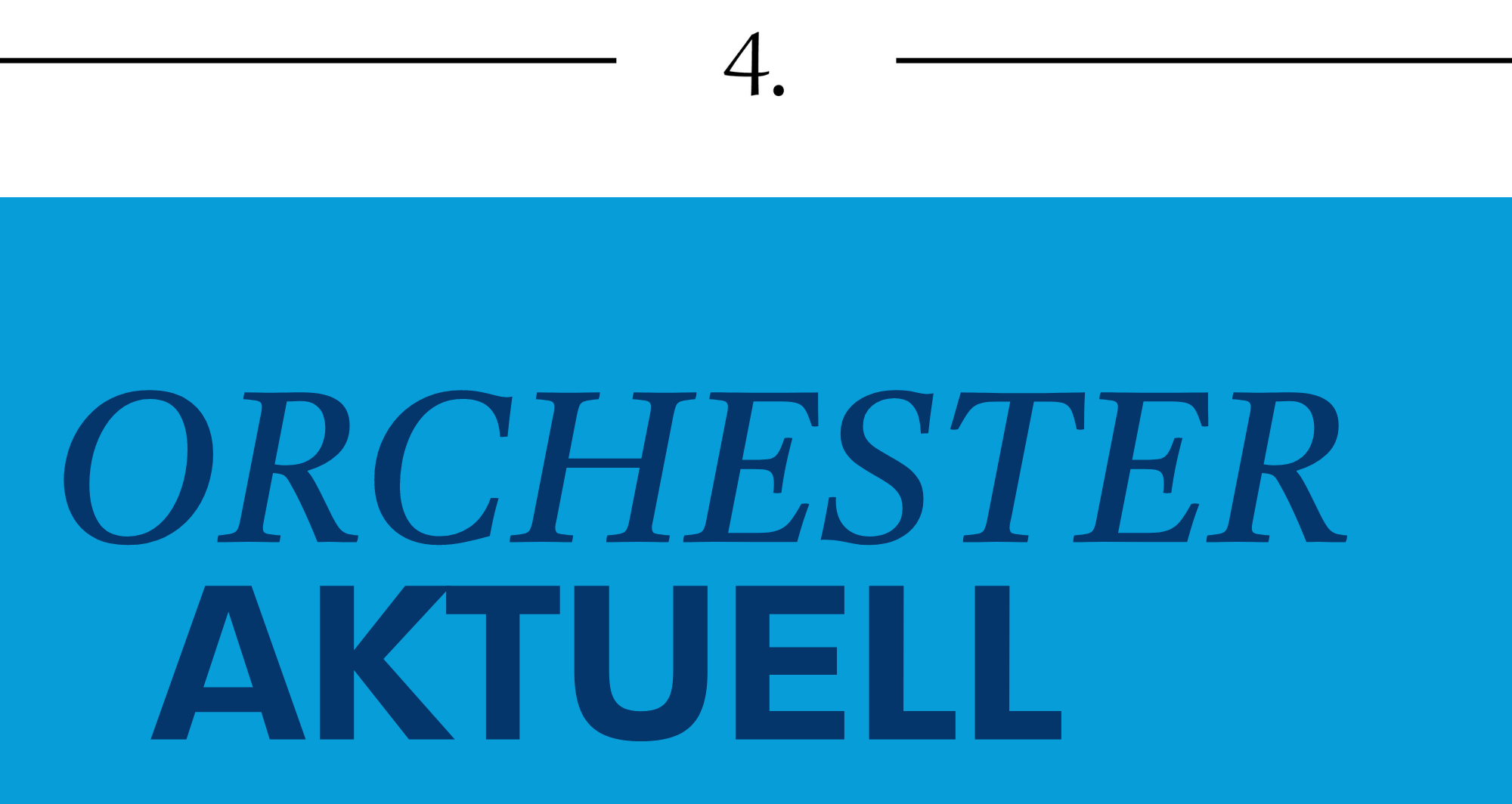

Michael Vogt wurde in Meiningen (Thüringen) geboren und studierte in Berlin an der Hochschule für Musik Hanns Eisler. 1986 trat der Solo-Tubist ins heutige Konzerthausorchester Berlin ein. Als Kammermusiker spielt er im Tubenduo „Tuba Wa Duo“, dem Berliner Tubenquartett und dem Kammerensemble Neue Musik Berlin. Uraufführungen, darunter das Konzert für Tuba und Orchester von Lutz Glandien mit dem Konzerthausorchester Berlin, führten ihn auf Festivals im In- und Ausland.