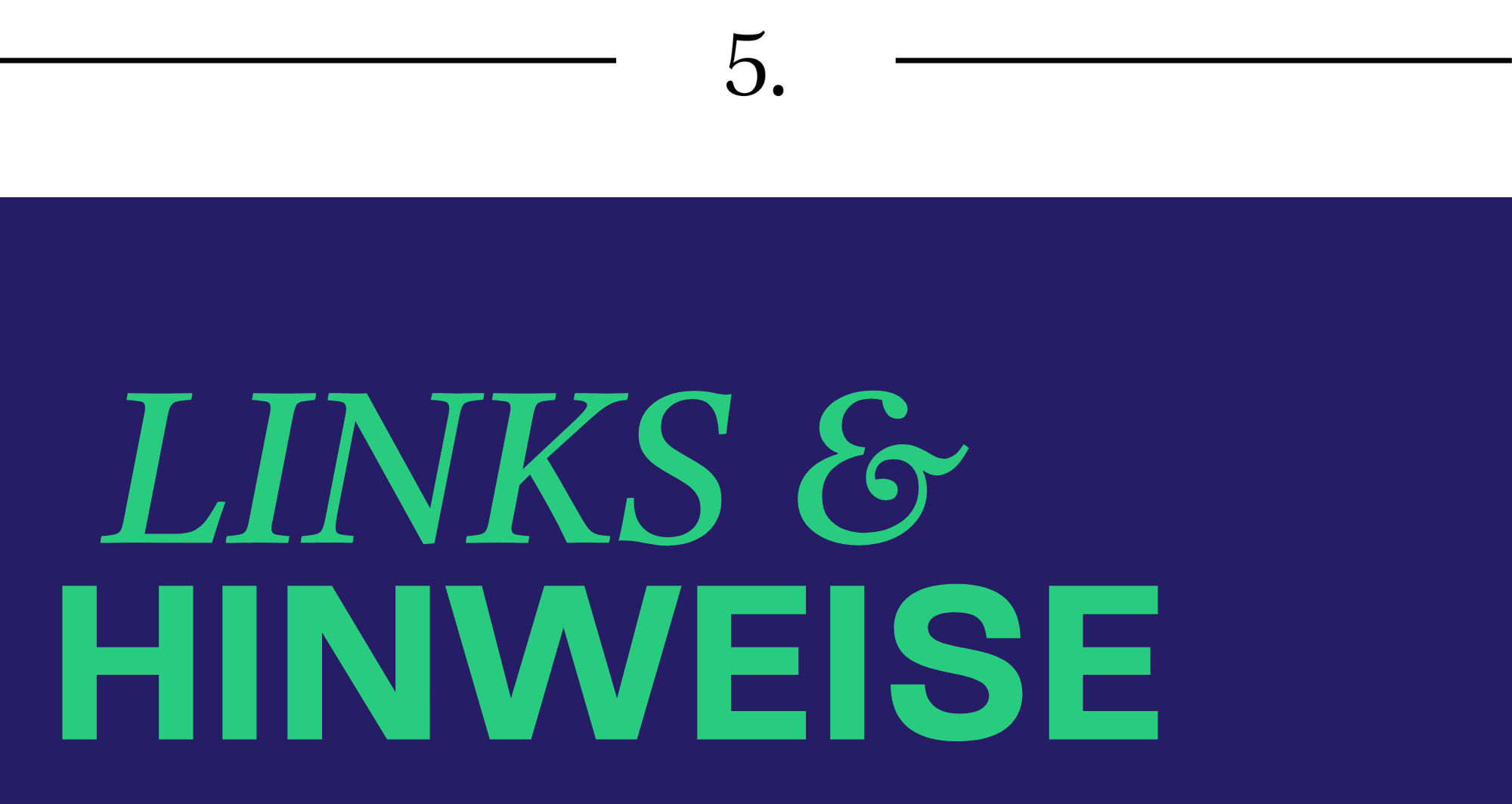16.00 Uhr
Konzerthausorchester Berlin, RIAS Kammerchor, Joana Mallwitz


Konzerthausorchester Berlin
Marc Albrecht Dirigent
Christian Tetzlaff Violine
Programm
Christian Jost (*1963)
Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 („Concerto noir“)
Deutsche Erstaufführung
Pause
Richard Strauss (1864–1949)
„Sinfonia domestica“ op. 53
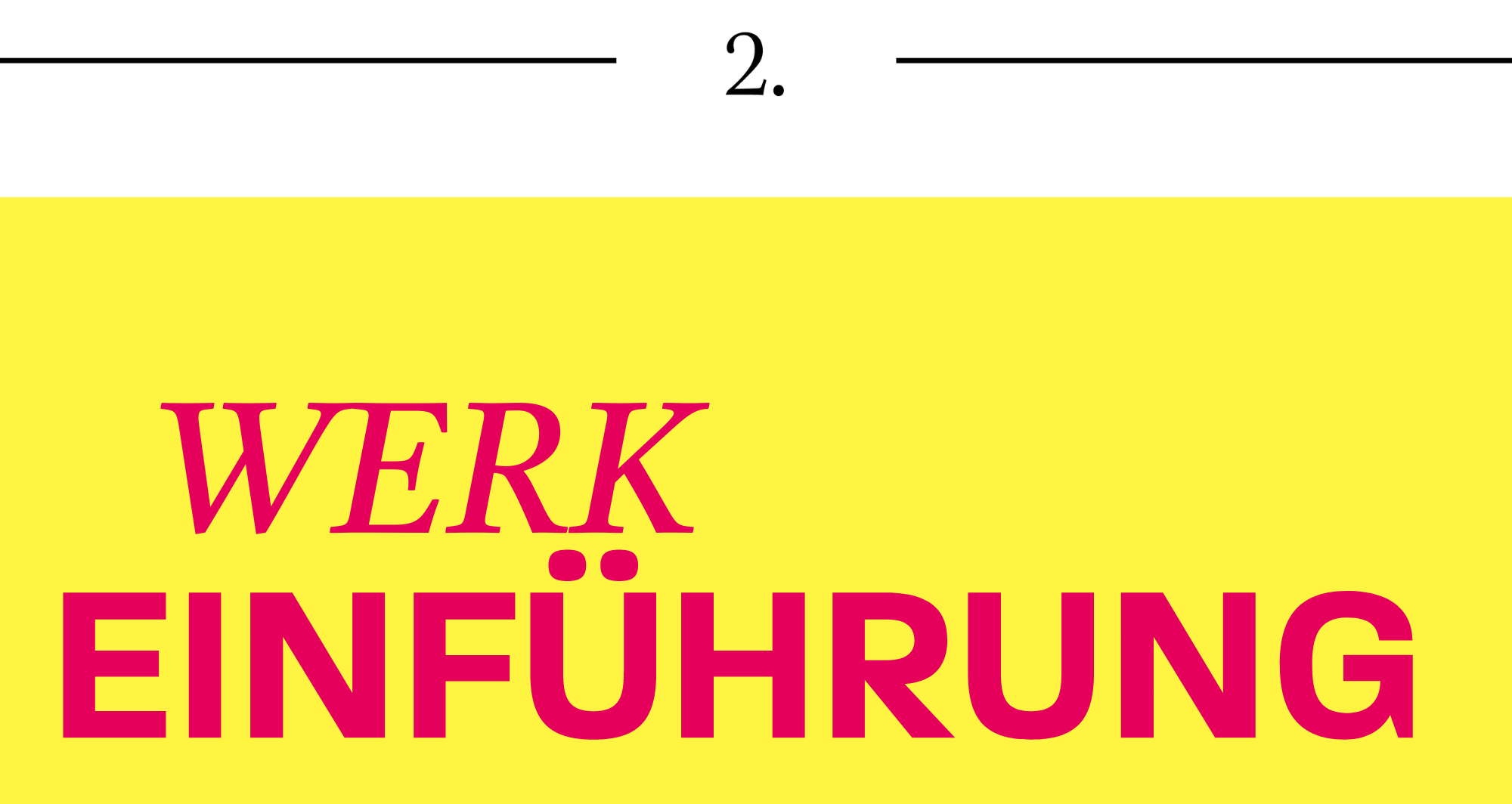
Der Titel verrät es schon: Das Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 von Christian Jost entführt uns in nächtliche Gefilde. „Concerto Noir“ hat der 1963 geborene Komponist es genannt. Jost selbst beschreibt das Werk, dessen reduzierte Version bereits 2020, beim Musikfest Berlin, vom Konzerthausorchester und dem Solisten Christian Tetzlaff vorgestellt wurde, als „dunkel getönt“ aber ohne „Schwere, die auf den Schultern lastet“. Das Stück, so der Komponist weiter, „geht direkt sehr aktiv los und hat ganz wenig Ruhepunkte. Es ist von einer starken Energie, von nach vorne peitschenden Rhythmen getrieben. Die Bläser werden in Anlehnung an jazzigen Big Band-Sound genutzt, dazu kommt relativ viel Schlagwerk und Klavier“. Der Charakter des „Concerto Noir“ ist rhapsodisch, wobei dem Solo-Instrument eine mindestens gleichberechtigte Rolle zufällt: Nicht einen Takt schweigt die Violine und unterstreicht damit ihre individuelle Stärke.
Voller Kraft steckt auch das zweite Werk des Abends, die „Sinfonia domestica“ von Richard Strauss – eine üppig instrumentierte Sinfonische Dichtung, die Strauss während seiner Zeit als preußischer Hofkapellmeister in den Jahren 1902/03 zu Papier warf, gewissermaßen als eine Art klingende Familien-Autobiographie. Die Partitur des einsätzigen, in vier Abschnitte (Allegro, Scherzo, Adagio, Finale) gegliederten Werkes trägt die Widmung „Meiner lieben Frau und unserem Jungen“. Die Orchesterbesetzung ist nicht anders denn opulent zu nennen: Einem mehr als 60-köpfigen Streicherensemble stehen unter anderem 8 (!) Hörner, je 4 Trompeten und Saxophone (eine Novität im Œuvre dieses Komponisten), 4 Fagotte sowie ein großer Schlagzeugapparat gegenüber.
Christian Josts „Concerto Noir“


Der Dichter singt. Singt von der Liebe, vom Leiden an ihr, von der Leidenschaft, von den Träumen, in denen ihm Tränen die Wangen herabtropfen, von all den dunklen Gestalten, die seinen Lebensweg immer wieder kreuzen, von verblichener, verblassender und doch ewig währender, wenngleich zielloser Hoffnung. Robert Schumanns „Dichterliebe“ auf Verse Heinrich Heines ist eines der Paradebeispiele für jene romantische Empfindsamkeit, die all jene Menschenkinder tagein, tagaus überwältigt, die das, was wir Welt nennen, als prekären Ort empfinden – und Liebe als einen Gefühlszustand, der schon in seinem Erblühen die Aura des Verschwindens in sich trägt. Als Christian Jost 2017 im Auftrag des Konzerthauses Berlin und des Copenhagen Opera Festival eine „Überschreibung“ (oder sollte man sagen: „Übermalung“?) wagte, stellte man sich im Stillen die Frage, ob dies nicht zugleich ein Angriff auf die Authentizität des berühmten Liedzyklus’ sei. Doch die feinnervig-tastende Art und Weise, in der Jost die Schumannschen Klangbilder ins Heute transformierte, fegte jegliche Bedenken sogleich hinweg. Das war eine neue, andere, eine spätmoderne „Dichterliebe“, mit einer Intensität und Fragilität, die dem Vorbild in nichts nachstand.
Wenn man in Josts zweites Violinkonzert „Concerto noir“ hineinhört, das in einer verkürzten Fassung als „Concerto noir redux“ 2020 beim Musikfest Berlin von Christian Tetzlaff und dem Konzerthausorchester Berlin unter Leitung von Christoph Eschenbach uraufgeführt wurde (und 2022 in Biel in seiner originalen Gestalt seine Weltpremiere feierte), stellen sich Erinnerungen an seine „Dichterliebe“ ein. Hier wie dort dominiert – der Titel insinuiert dies bereits in aller Deutlichkeit – ein dunkel getöntes Klangbild, doch wie durch einen Türspalt scheint in beiden Kompositionen momentweise ein mildes Licht hindurch, klingender Hoffnungsschimmer. Versinnbildlicht wird dieser in erster Linie durch das Soloinstrument, das in diesem rhapsodisch geformten Stück keine Sekunde lang schweigt und sich couragiert immer wieder einen Weg durch das Dickicht des Orchesterklangs sucht. Schon die Spielanweisung espressivo zu Beginn der Partitur gibt uns einen Hinweis. Und mag das vorgegebene Tempo auch grundsätzlich ein eher langsames sein (die Viertel sind mit 76 notiert), so hindert es die Solo-Violine zu keiner Zeit daran, einen Gesang der Freiheit mit virtuosem Flügelschlag anzustimmen.


Im Orchester selbst finden sich – neben der „klassischen“ Streicherbesetzung – einige dezidiert dunkle Farbtöne: Altflöte, Kontrafagott, Bassklarinette, Bassposaune. Dazu gesellt sich ein nicht minder ausladendes Schlagwerk mit Vibraphon, Marimba, chinesischem Becken, zwei Timbals, sechs Tomtoms, einer großen Trommel und zwei Woodblocks. Am Anfang des „Concerto noir“ aber steht der Dialog der Solostimme mit ihren Schwestern, den ersten Violinen. Eine Art (durch Glissandi erzeugte) Reibung, die sich im Folgenden aber immer wieder auflöst, insbesondere durch die improvisierend ausgreifenden, nicht selten arabesken, das gesamte Orchester überstrahlenden Melodielinien der Solo-Violine. Als Kraftzentrum hat Jost das kleine „a“ bestimmt. Um diesen Ton, von dem aus sich die erste Kantilene emporschwingt, kreist im Grunde das gesamte Stück, wobei in einem ekstatischen Moment aus dem „kleinen“ ein dreigestrichenes „A“ wird, das wie ein Stern am Klanghimmel steht, einsam, aber dauerhaft leuchtend.
Das Orchester gibt diesen „Ausflügen“ zur Sonne metrische Kontur, einen (hier und da polyrhythmisch verkanteten) Grundpuls. Wie ein leises Pochen unterlegen zunächst Streicher, später die Holz- und Blechbläser den an- und abschwellenden Gesang der Solo-Violine, der die gesamte Palette an Ausdrucks- und Spielmitteln nutzt und sich zuweilen in aberwitzigen Kaskaden in den Raum ergießt.
Die eklatante Virtuosität des zweiten Violinkonzerts stellt dieses auf eine Stufe mit den großen romantischen Konzerten eines Mendelssohn, Schumann, Brahms oder Tschaikowsky. Was Josts Stück von diesen unterscheidet, ist das Verhältnis zwischen Individuum und Masse. Denn nie je kommt das autonome Subjekt, als das wir die Solo-Violine begreifen dürfen, zur Ruhe (mit einer einzigen Ausnahme: einer winzigen Atempause in den Takten 324 und 325); in schier unzähligen, dynamisch facettenreichen Anläufen „kämpft“ es einen Löwenkampf gegen die Klänge, die es umrunden, bedrohen, zu ersticken suchen. Entspannung gibt es selten, so wie in jener kurzen Passage ab Takt 110, in der die Solo-Violine einen Dialog mit den Holzbläsern führt, bevor sich erst die Streicher und dann das Blech wieder „einmischen“. Auf diese besänftigende Klangrede folgt ein Teil, in dem das Solo-Instrument, erneut um das Kraftzentrum „a“ kreisend, sein Heil in einer fast tänzerisch rhythmisierten Gestik sucht. Von dort aus führt der Weg gleichsam zum Anfang zurück, zu jenem Dreiton-Motiv, aus dem heraus sich das musikalische Geschehen entwickelt hat. Und auch hier blinzelt kurz ein Sonnenstrahl durchs Dickicht: cantabile wünscht sich der Komponist diese Art Mittelsatz, der aber schon bald (über einem recht statuarischen Orchesterklang) die Spielzone ausweitet und mit etlichen Zuspitzungen gespickt ist – bis hin zu jenem schon erwähnten ekstatischen Augenblick, in dem die Solo-Violine sich über einige Sextolen-Ketten und raumgreifende Arpeggien in höchste Höhen hinauf schwingt und das entfesselte Orchester gleichsam „überbietet“, um kurze Zeit später von diesem Berggipfel singend wieder hinabzusteigen in vertraute (pianissimo-)Gefilde. Danach wird das musikalische Geschehen übersichtlicher, die (mal von einem leisen Pochen des Schlagwerks, mal von tiefen Holzbläsern unterlegten) Episoden erscheinen als verknappt, birgt aber nur die berühmte Ruhe vor dem finalen Sturm. Begleitet vom gesamten Orchester, strebt die Solo-Violine ein letztes Mal hinauf in den dreigestrichenen Diskant, mit rasanten Glissandi, Doppelgriffen und zunehmender Intensität des Ausdrucks, bis hin zu jener Kulmination im fortissimo, die das „Concerto noir“ beschließt. Wenn man so will: in der Schwärze der Nacht.
Richard Strauss‘ „Sinfonia domestica“ op. 53


Im Traumreich des Daseins suchte man im Wien um 1900 mit aller Macht nach jenen Dämonen, die in der menschlichen Seele wohnen. Freuds „Traumdeutung“, Weiningers krude Studie „Geschlecht und Charakter“, Schnitzlers frivole Dramen sind nur einige Beispiele für die Tendenz, Tiefenbohrungen ins Innerste vorzunehmen. Richard Strauss war von solchen Ideen kaum je angetastet. Sein Reich war und blieb die Musik, und neben der Oper „Salome“ (deren monetärer Erfolg den Bau des noblen Garmischer Heims ermöglichte) bastelte er zu dieser Zeit auch an einer Sinfonischen Dichtung, die bis heute viele Musikliebhaber und auch Experten fragend zurücklässt. Straussens „Sinfonia domestica“ ist – in der Nachfolge der stürmischen Tondichtungen „Till Eulenspiegel“, „Don Quixote“ und „Ein Heldenleben“ – nicht nur Beleg für die große Meisterschaft dieses Komponisten (wie ebenso Beweis für seine Neigung zur üppigsten Instrumentation; man denke nur an die 8 Hörner!), sie zeigt auch die anmaßende Virtuosität ihres Schöpfers, der nicht einmal davor zurückschreckte, sein Privatleben in tönend bewegte Formen zu zwingen. Das Publikum wird gleichsam zum Voyeur eines mondän-erotischen Geschehens, das vor aller Welt die privatesten Neigungen der Familie Strauss gleichsam klingend protokolliert. Ob man darin nun ein Programm vermuten will oder nicht, spielt letztlich keine entscheidende Rolle. Das (Kunst-)Werk selbst ist offen genug, um darin nach Belieben lesen zu können.
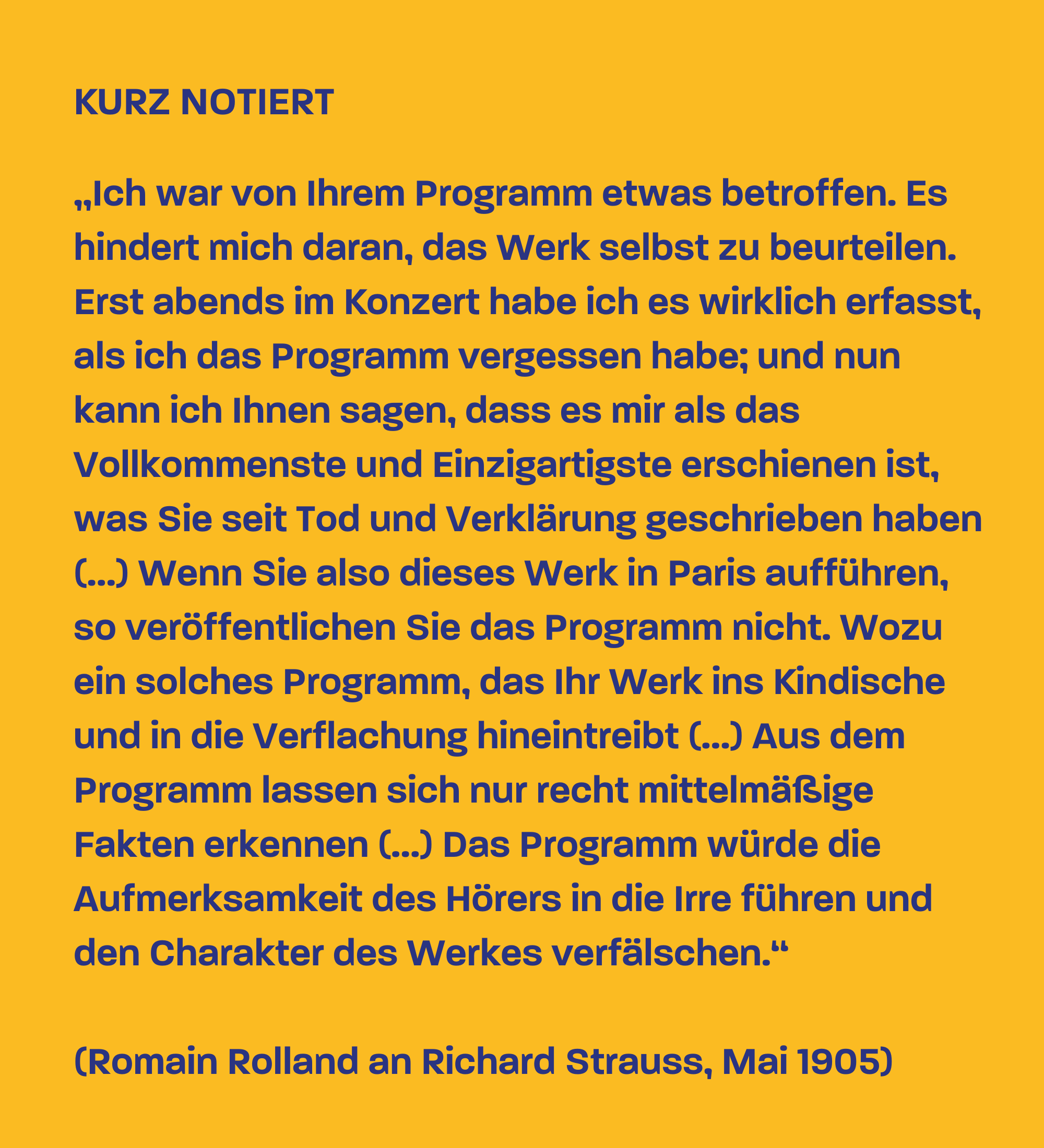
Formal gliedert sich die „Sinfonia domestica“, wiewohl einsätzig, in vier attacca ineinander übergehende Abschnitte (Allegro, Scherzo, Adagio, Finale), die man als Teile einer Situationsfolge begreifen darf – als vier Kapitel eines klingenden Buches. Das motivische Material besteht aus drei streng definierten Komplexen, die der Komponist in größtmöglicher Schlichtheit als „I., II. und III. Thema“ bezeichnet und den drei (imaginären) Protagonisten zuordnet: „Mann/Papa“, „Frau/Mama“, „Kind/Bubi“. Die beiden ersten Themen verknüpfen mehrere Motive, die wiederum mit Eigenschaften bezeichnet sind: „Bewegt“ wünscht sich Strauss „sein“ Thema, das in der Folge verschiedene „Eigenschaften“ (und Tonarten) annimmt, die man getrost als vielschichtige Charakteristika ihres Schöpfers wahrnehmen darf: Erst ist es (besser: er, der Herr Papa) „gemächlich“ (eine tapsige Melodie in den Violoncelli), dann „träumerisch“ (eine elegische Solo-Oboe), „mürrisch“ (vergrummelte Klarinetten), „feurig“ (emphatische Erste Violinen), schließlich, „lustig, frisch“ (eine kecke Solo-Trompete). Man mag, wie es Romain Rolland getan hat, all diesen „Themen“ eine gewisse (und gewollte) Hüftsteifigkeit unterstellen, doch der musikantische Gestus überwölbt diese Starre problemlos.

Seiner „besseren Hälfte“ (gemeint ist die gestrenge Gattin Pauline, die, glaubt man den Berichten der Zeitzeugen, aus dem renommierten Komponisten daheim einen wahren Pantoffelhelden machte und ihm sogar den Titel seiner berühmtesten Oper, dem „Rosenkavalier“, diktierte) widmet Strauss das zweite Thema, eine sprunghaft-vitale H-Dur-Melodie, die von Flöten, Oboen und Ersten Violinen vorgestellt wird und sich danach fast hemmungslos „ausbreitet“, indem es durch mehrere Tonarten hindurch tanzt. Wenig Wunder, verschmelzen beide Themen in der Folge miteinander, und in manchem Takt möchte man sogar hören, wie intensiv körperlich sie dies tun – Vorgriff auf den unverhohlen drastischen „Liebesakt“-Beginn des „Rosenkavalier“. Als gleichsam geglücktes logisches Ergebnis dieses munteren Dialogs erscheint daraufhin das dritte Thema („Kind/Bubi“), Strauss hat es, als liebender Vater, der Oboe d’amore überantwortet mit ihrem mild-weichen, samtenen Klang und verquickt es in der Folge mit den beiden anderen Themen: die heilige Familie im traulichen Zwiegespräch.
In den drei weiteren Abschnitten wird dieses Prinzip weitergeführt und variiert. An ein quicklebendiges Scherzo schließt sich ein sanft-elegisches, wiegenliedhaftes Adagio an, das keinen Hehl aus seiner musikalischen wie semantischen Nähe zu Mahlers wenige Monate zuvor uraufgeführter G-Dur-Sinfonie auszeichnet und im Kontext der Sinfonischen Dichtung wie ein (zwischen erotischer Wallung und Rekreation wankendes) Notturno anmutet. Der Morgen danach beginnt kompliziert – mit einer Doppel-Fuge, die es in vielerlei Hinsicht buchstäblich in sich hat und sich auf dialektischem Feld bewegt. Erstes und zweites Thema widersprechen sich allein schon durch die Wahl der Tonart: d-Moll trifft auf D-Dur, die Dunkelheit auf das Licht. Dass am Ende Letzteres siegt, durfte man erwarten – Richard Strauss dachte nicht daran, von seiner trauten Familie ein trauriges sinfonisches Porträt zu zeichnen.



Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.
1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.
Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Geprägt wurde Marc Albrecht von seinem Mentor Claudio Abbado, als dessen Assistent er, nach dem Studium in Wien und ersten Korrepetitor-Stellen an den Staatsopern von Wien und Hamburg, das Gustav Mahler Jugendorchester mit aufbaute und fünf Jahre lang betreute. Anschließend wurde er Erster Kapellmeister an der Sächsischen Staatsoper Dresden und 1995, mit 30 Jahren, einer der jüngsten Generalmusikdirektoren Deutschlands, am Staatstheater Darmstadt.
2006 übernahm er die Leitung des Orchestre Philharmonique de Strasbourg, 2011 wechselte er nach Amsterdam, wo die Oper wieder ins Zentrum seiner Arbeit rückte (bis 2020). Zu einem Meilenstein wurden im September 2014 die erste szenische Fassung von Schönbergs „Gurre-Liedern“ überhaupt (Regie von Pierre Audi) sowie Pierre Audis legendäre Inszenierung von Wagners „Die Walküre“.
Marc Albrecht wurde im Oktober 2021 mit dem Opus Klassik als „Dirigent des Jahres“ ausgezeichnet. Während seiner Amtszeit als Chefdirigent wurde De Nederlandse Opera 2016 zu Europas „Opernhaus des Jahres“ gekürt. Marc Albrecht erhielt 2019 den International Opera Award als „Dirigent des Jahres“ und wurde für sein umfangreiches Schaffen 2020 zum Ritter des Ordens des Niederländischen Löwen ernannt; zudem erhielt er den Prix d'Amis 2020, der jährlich von den Freunden der Dutch National Opera verliehen wird. 2019 wurde die Produktion von Alban Bergs „Wozzeck“ an der Nederlandse Opera aus dem Jahr 2017 für einen Grammy in der Kategorie „Best Opera Recording“ nominiert. Die im Juni 2019 auf NAXOS erschienene DVD der gefeierten Produktion „Das Wunder der Heliane“ an der Deutschen Oper Berlin unter Albrechts musikalischer Leitung gewann 2020 den Opus Klassik in der Kategorie „Beste Operneinspielung 20./21. Jh“. Gastdirigate führen Marc Albrecht in dieser Saison an die Opernhäuser in Berlin, Köln, Rom und Dresden; er gastiert außerdem unter anderem beim Netherlands Philharmonic Orchestra, der Philharmonia Zürich, Oslo Philharmonic, Orquesta de Valencia, Gulbenkian Orchestra Lissabon und beim Taiwan Philharmonic.
Beim Konzerthausorchester war Marc Albrecht zuletztam Karfreitag 2023 zu Gast.

Der 1966 in Hamburg geborene Musiker hat bei Uwe-Martin Haiberg an der Musikhochschule Lübeck studiert. Er pflegt heute ein ungewöhnlich breites Repertoire und engagiert sich besonders für neue Werke wie das von ihm 2013 uraufgeführte Violinkonzert von Jörg Widmann. Zu den Höhepunkten der letzten Spielzeit zählen Tourneen mit den Hamburger Philharmonikern, dem London Philharmonic Orchestra und dem Bundesjugendorchester sowie eine Südamerika-Tournee mit Der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Regelmäßig ist Christian Tetzlaff auch zu japanischen und US-amerikanischen Orchestern eingeladen.
Christian Tetzlaff wird regelmäßig als Residenzkünstler bei Orchestern und Veranstaltern eingeladen, so bei den Berliner Philharmonikern, dem Seoul Philharmonic Orchestra und den Dresdner Philharmonikern, in der Saison 2021/22 bei der Londoner Wigmore Hall, und 2022/23 war er „Portrait Artist“ beim London Symphony Orchestra. Enge künstlerische Zusammenarbeit verbindet ihn unter anderem mit David Afkham, Marc Albrecht, Francesco Angelico, Ed Gardner, Barbara Hannigan, Cornelius Meister, Ingo Metzmacher und Kent Nagano.
Bereits 1994 gründete Christian Tetzlaff mit seiner Schwester, der Cellistin Tanja Tetzlaff, sein eigenes Streichquartett. 2015 wurde das Quartett mit dem Diapason d’or ausgezeichnet; das Trio mit seiner Schwester Tanja Tetzlaff und dem Pianisten Lars Vogt im darauffolgenden Jahr für den GRAMMY nominiert.
Christian Tetzlaff spielt eine Geige des deutschen Geigenbauers Peter Greiner und unterrichtet regelmäßig an der Kronberg Academy. Er lebt mit seiner Frau, der Fotografin Giorgia Bertazzi, und drei Kindern in Berlin.
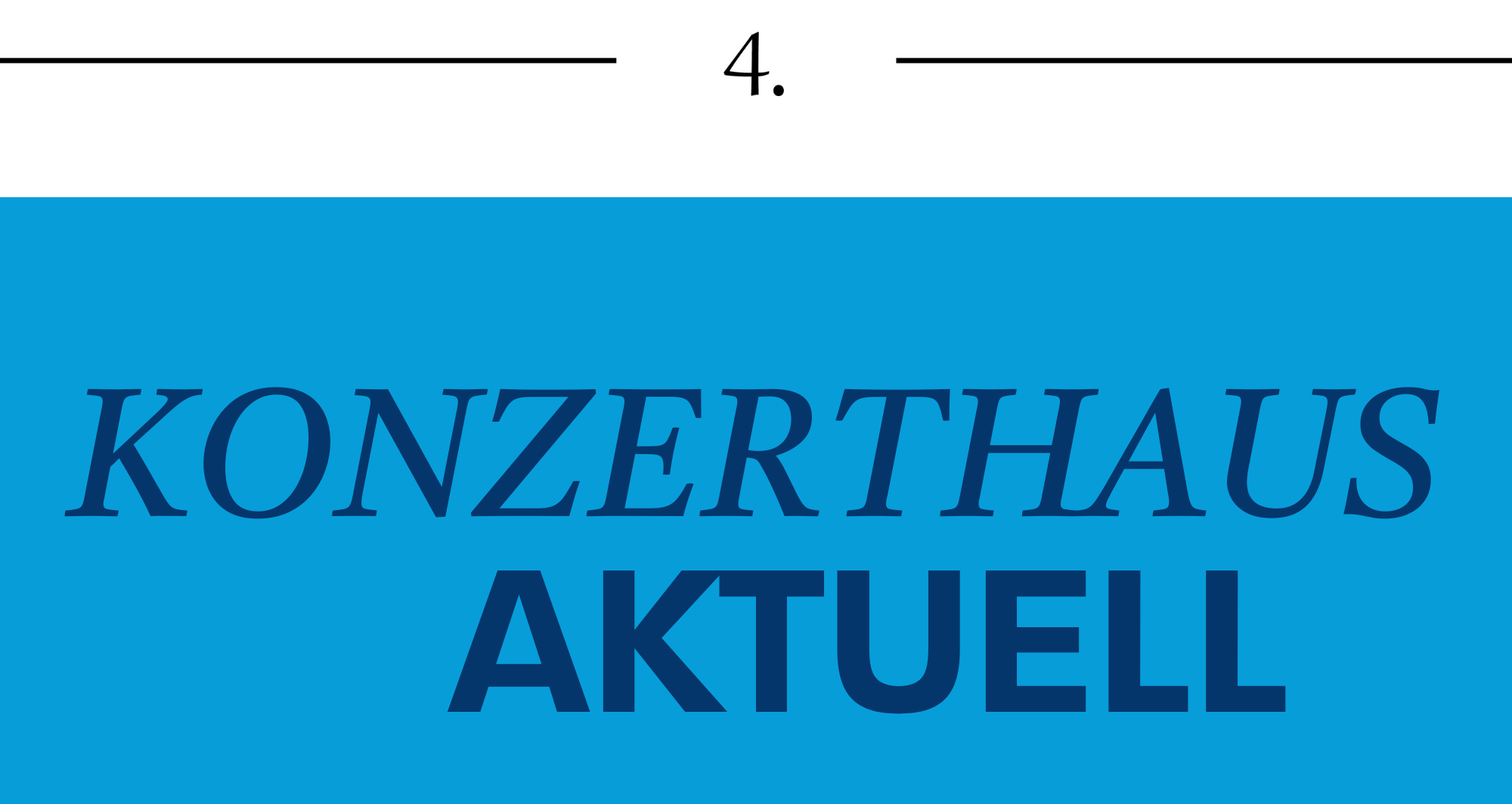

Miteinander musizieren heißt voneinander lernen. Das gilt insbesondere für eine Orchesterakademie, wo talentierte Nachwuchsmusiker*innen aus aller Welt zusammenkommen, um gemeinsam mit den Orchestermitgliedern zu spielen. Die Orchesterakademie am Konzerthaus Berlin bietet jedoch noch mehr: Akademist*innen bekommen bis zu zwei Jahre ein Stipendium. Während dieser Zeit steht ihnen aus dem Orchester jeweils ein*e Mentor*in der eigenen Stimmgruppe zur Seite, unterrichtet sie und führt sie in die Spieltradition des Konzerthausorchesters ein.