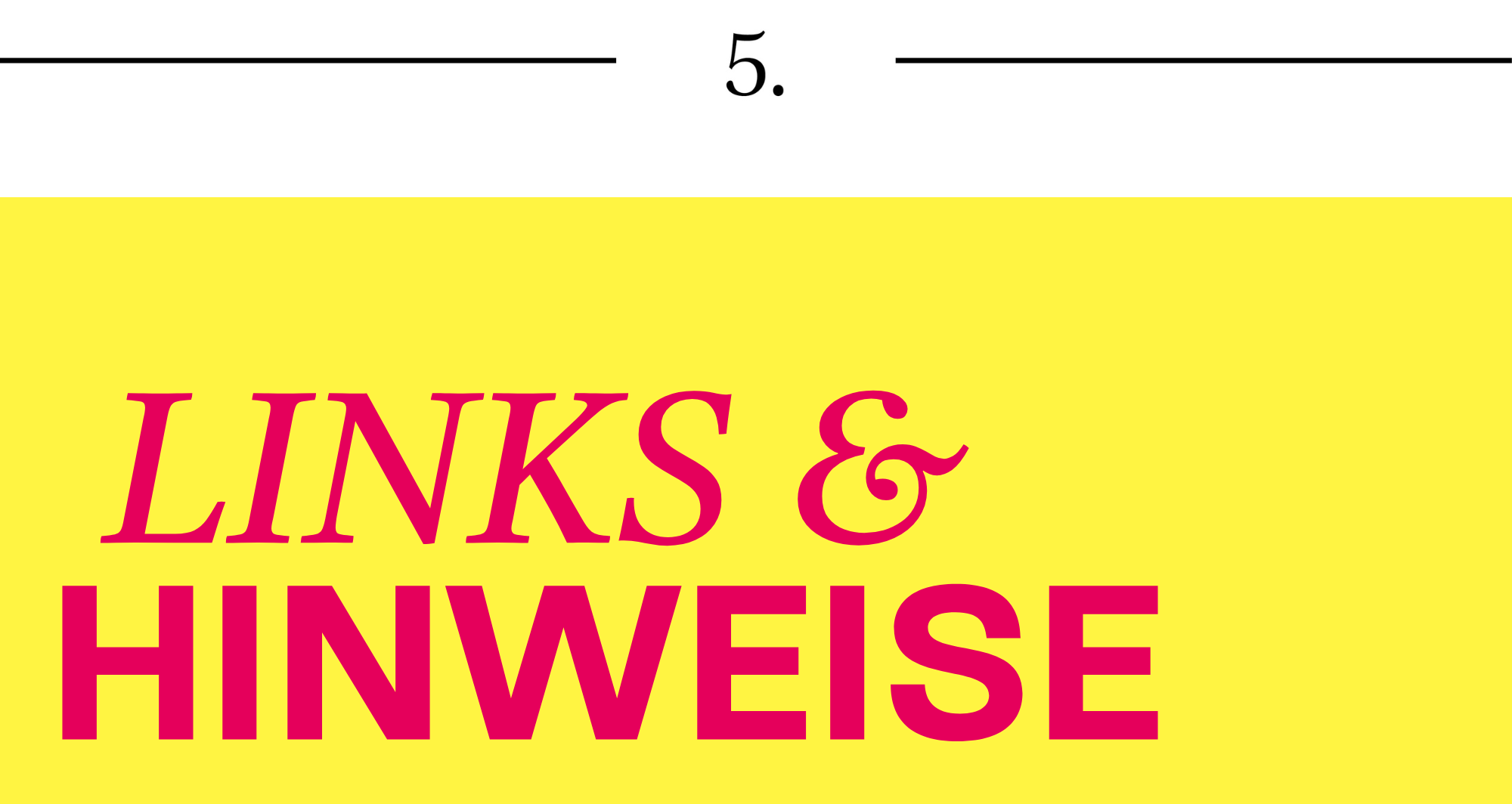11.00 Uhr
cappella academica, Christiane Silber

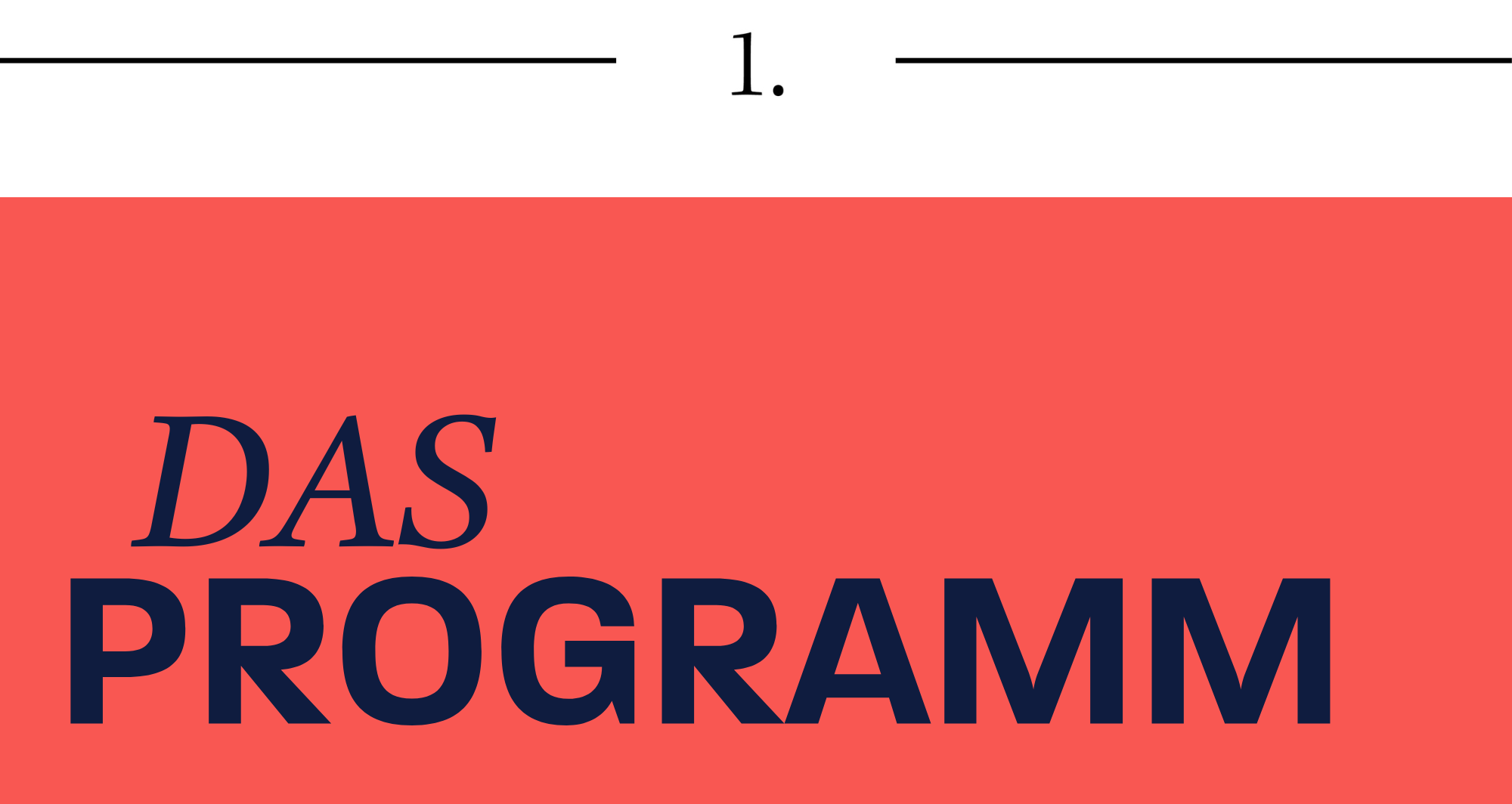
Matinee des Konzerthausorchesters Berlin
Suyoen Kim Violine
Jiyoon Lee Violine
Petr Matĕják Violine
Andreas Feldmann Violine
Kyungsik Shin Viola
Nilay Özdemir Viola
Tony Rymer Violoncello
Taneli Turunen Violoncello
Programm
George Enescu (1881 – 1955)
Oktett C-Dur op. 7
Très modéré –
Très fougeux – Moins vite – 1er Mouvement
Lentement – Plus vite – 1er Mouvement
Mouvement de Valse bien rythmée
PAUSE
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Oktett Es-Dur op. 20
Allegro moderato ma con fuoco
Andante
Scherzo. Allegro leggierissimo
Presto
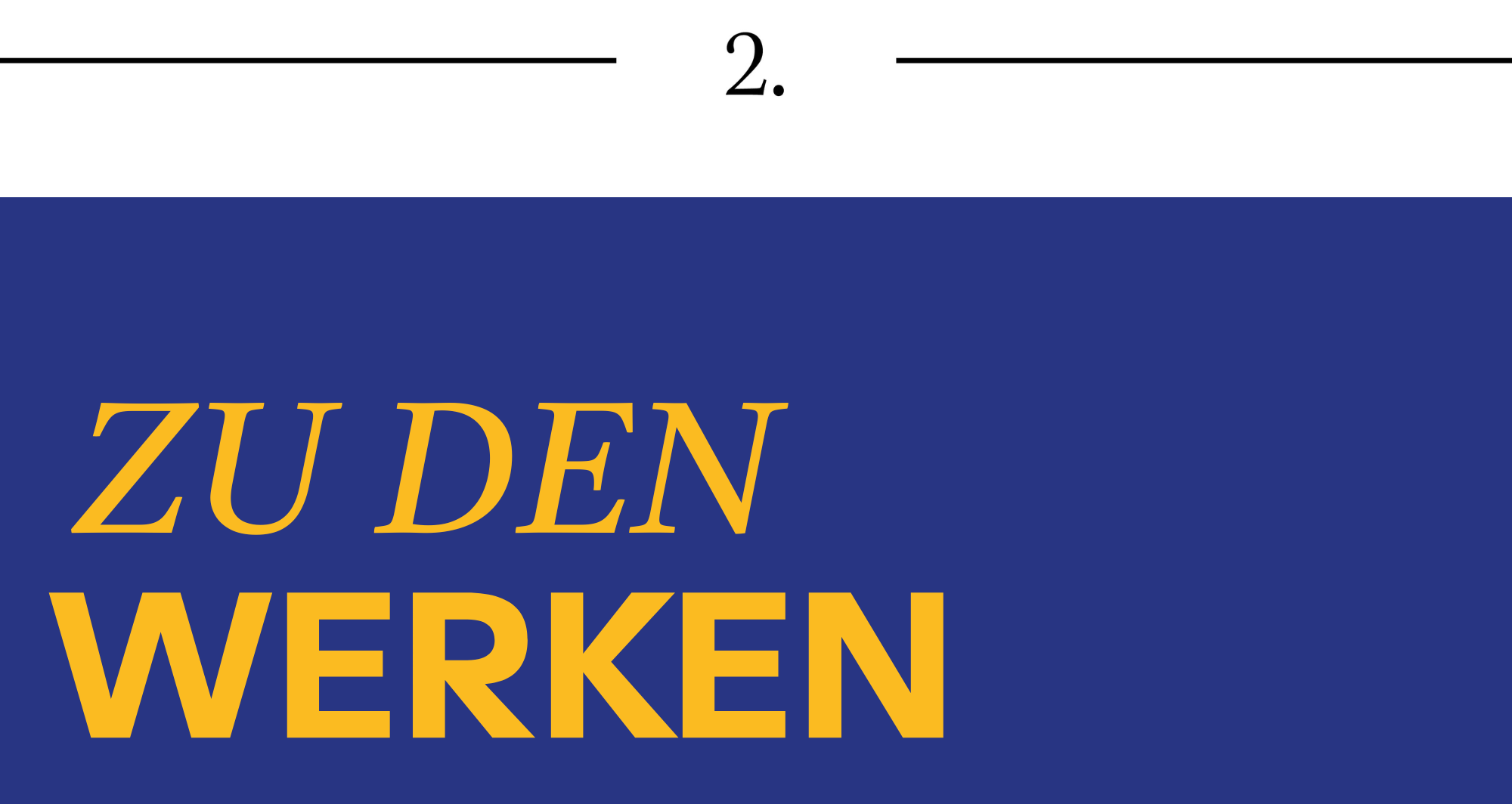
Ein großes Ganzes
Einst berühmt als Komponist, Geiger und Dirigent, hat George Enescu heutzutage in den Konzertprogrammen nur selten einen Platz. Wobei man zugeben muss, dass schon zu seinen Lebzeiten – ab 1895 wohnte Enescu vor allem in Paris – der Ruhm des Interpreten den des Komponisten überdeckte. Die Vielfalt seiner musikalischen Talente macht die Eigenart des Rumänen ebenso aus wie die Vielfalt der Traditionslinien, die in seinem Leben Schnittpunkte fanden. Geboren in einem moldawischen Dorf, erhielt er dort mit vier Jahren auch den ersten Geigenunterricht. Als Siebenjähriger kam er zum Studium ans Wiener Konservatorium und wurde hier von Joseph Hellmesberger junior und Robert Fuchs insbesondere mit deren Idol Johannes Brahms vertraut gemacht. Zwei Jahre später, am Pariser Konservatorium, waren seine Lehrer beispielsweise Jules Massenet und Gabriel Fauré, einer seiner Mitschüler Maurice Ravel. Zur frühen volksmusikalischen Prägung und zur deutsch-österreichischen Romantik traten nun die Fülle französischer Melodik und impressionistischer Klangsinn.
Sein etwa vierzigminütiges Streichoktett schrieb Enescu 1900 in Paris. Tradition und Neuerung finden im Werk zueinander, klassische Viersätzigkeit zu einem einzigen „Sinfoniesatz“, dessen Abschnitte der Sonatenhauptsatzform folgen. Ob sich dem Oktett die in Besprechungen immer wieder beschworene Schubert- und Brahms-Nähe tatsächlich ablauschen lässt, mag jeder Hörer selbst entscheiden. Höchst individuell ist auf alle Fälle gleich der Beginn mit dem im markanten Unisono vorgestellten Hauptthema, das Enescu im Fortgang kunstvoll auffächert. Unvermittelt setzt der zweite Satz mit auffahrender Bewegung ein und bietet in seiner chromatischen Raserei nur wenig Platz für zarte Reminiszenzen. In wiederum deutlichem Gegensatz eröffnen den dritten Satz fast sakral anmutende Akkorde, und diese tiefe Ruhe rettet sich zunächst auch in das unauffällig anhebende Finale hinüber, das sich bald als – kaum tanzbares – „Mouvement de Valse“ entpuppt und seine eigentliche Berufung in einer Fuge findet. Wie uns ein Unisono in das Werk geleitet hat, leitet uns eines auch wieder heraus.
Faustisch?
Frühreife Meister: Enescu war bei der Komposition seines Oktetts neunzehn, Mendelssohn gar erst sechzehn. „Mein Felix fährt fort und ist fleißig“, schrieb Carl Friedrich Zelter, Mendelssohns Kompositionslehrer, im November 1825 nach Weimar an seinen Freund Goethe. „Er hat soeben wieder ein Oktett für acht obligate Instrumente vollendet, das Hand und Fuß hat.“ Das Klima, in dem das junge Genie in Berlin reifte, war das denkbar beste: Nicht nur die Musik erlernte der Enkel des Philosophen Moses Mendelssohn bei den erlesensten Lehrern, sondern auch etwa Sprachen und Zeichnen. Hatte sich die künstlerische, philosophische und wissenschaftliche Elite der Stadt schon zuvor im Hause Mendelssohn die Klinke in die Hand gegeben, erreichte die Geselligkeit 1825 mit dem Umzug in ein herrschaftliches Domizil in der Leipziger Straße eine neue Stufe. Und hier, im Gartensaal, erklang Felix‘ Streichoktett im Oktober des Jahres bei den legendären „Sonntagsmusiken“ zum ersten Mal. Öffentlich uraufgeführt wurde es erst am 30. Januar 1836 in Leipzig, mit Mendelssohn – inzwischen Gewandhauskapellmeister – an einer der beiden Bratschen.
Mendelssohn selbst hat das Oktett in die Nähe der Orchestermusik gerückt, es müsse „von allen Instrumenten im Style eines symphonischen Orchesters gespielt werden. Pianos und Fortes müssen genau eingehalten und schärfer betont werden als gewöhnlich in Werken dieses Charakters.“ Im quicklebendigen ersten Satz ist das Hauptthema kraftvoll, das Seitenthema gesanglich. Das Andante, das durch zahlreiche Tonarten streift, zeigt sich als Ruheplatz in durchsonnter Landschaft; das fugierte, geschäftige Finale greift mitunter thematisch auf zuvor Erklungenes zurück. Besonderes Augenmerk verdient das Scherzo – vor allem weil sich Mendelssohn, bekanntlich ja der Epoche der Romantik zugerechnet, hier am romantischsten erweist, aber auch eines außermusikalischen Bezugs wegen, den uns Fanny, die Schwester des Komponisten, offenbarte. Demnach hätten Zeilen aus Goethes „Faust“ die Inspiration geliefert: „Wolkenzug und Nebelflor/ erhellen sich von oben./ Luft im Laub und Wind im Rohr,/ und alles ist zerstoben.“ „Mir allein sagte er“, so Fanny, „was ihm vorschwebt ... Alles ist neu, fremd und doch so ansprechend …, man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben, ja man möchte selbst einen Besenstiel zur Hand nehmen … Am Schlusse flattert die erste Geige federleicht auf – und alles ist zerstoben.“
Fannys Tagebucheintrag hat nun die Fantasie des einen oder anderen Musikologen auf die Reise geschickt. So stellt zum Beispiel der Amerikaner R. Larry Todd in seinem 2003 erschienenen Mendelssohn-Buch „rein spekulative“ Überlegungen an, ob nicht im Kopfsatz die Partie der Ersten Geige ganz allgemein „faustische Qualität“ habe, das Andante Gretchen beim Gottesdienst vor der Walpurgisnacht und das Finale das Ringen um ihre Seele schildere. Da sollte man dann wohl doch besser die Musik ganz einfach genießen und auf die Deutungen mit Mephistopheles entgegnen: „Ein Kerl, der spekuliert, / ist wie ein Tier, auf dürrer Heide/ von einem bösen Geist im Kreis herumgeführt,/ und ringsumher liegt schöne grüne Weide.“
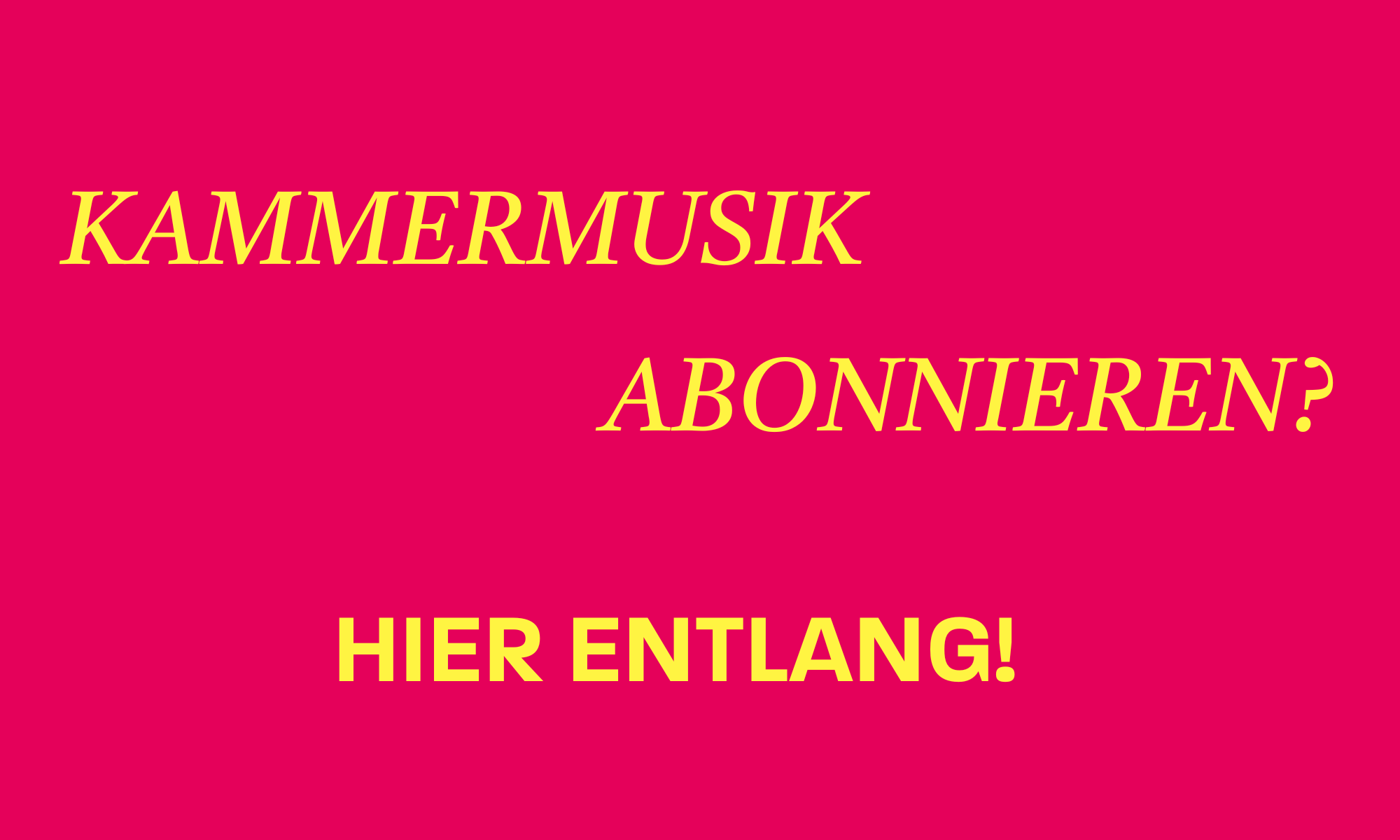
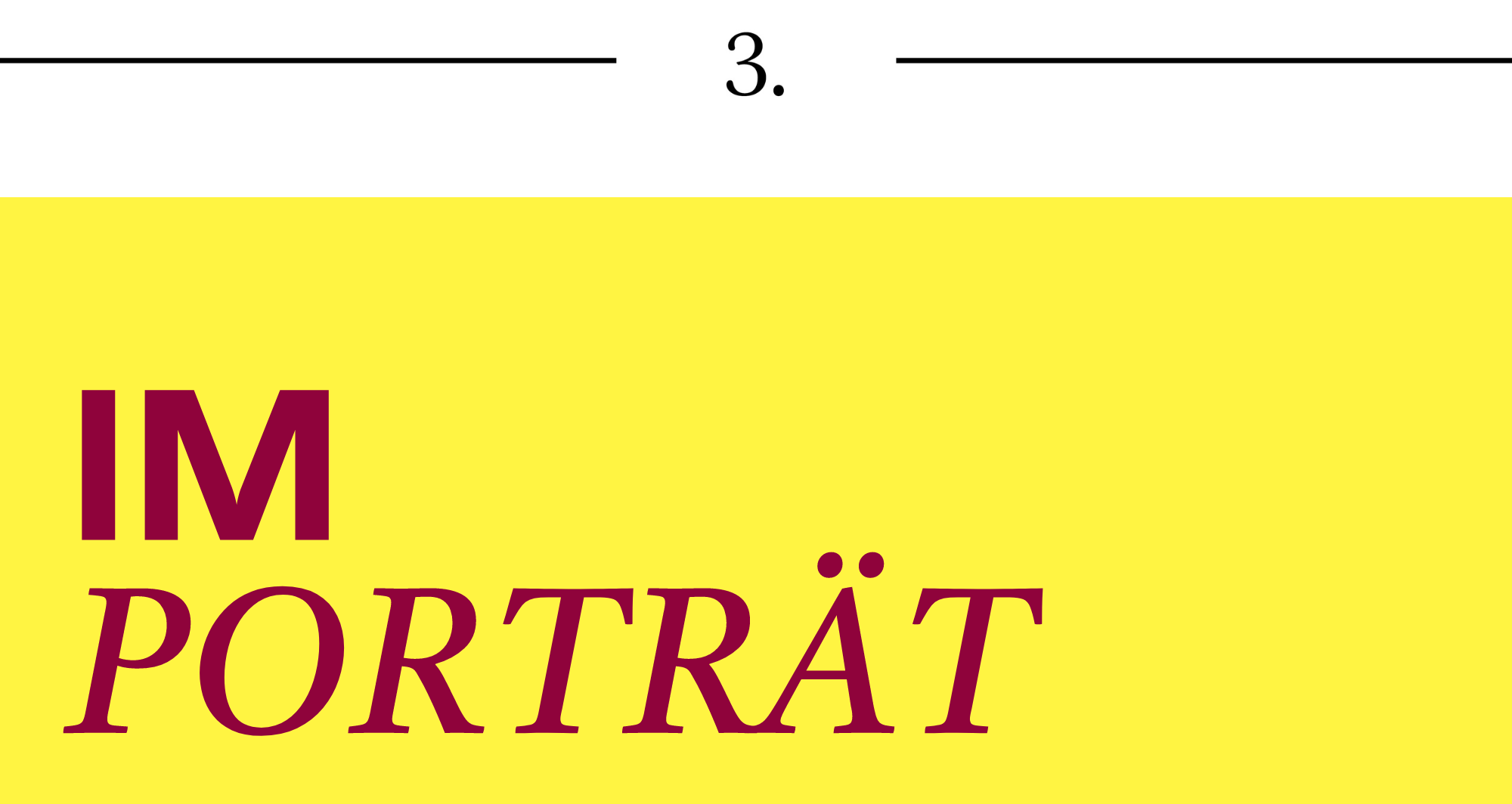
ist Erste Konzertmeisterin des Konzerthausorchesters Berlin. Sie wurde in Münster geboren und studierte in ihrer Heimatstadt bei Helge Slaatto, in München bei Ana Chumachenco sowie an der Kronberg Academy. Seit 2018 ist sie Mitglied des Konzerthausorchesters, seit 2019 war sie außerdem Mitglied im Artemis Quartett. Sie ist Gewinnerin des Internationalen Violinwettbewerbs Hannover (2006) und Preisträgerin des Brüsseler Königin-Elisabeth-Wettbewerbs (2009). Als Solistin ist Suyoen Kim mit diversen renommierten Orchestern in Europa, Asien und Südamerika aufgetreten. Sie ist Mitglied im aktuellen Künstlerischen Beirat.
1992 in Seoul (Südkorea) geboren, studierte Jiyoon Lee an der Korean National University of Arts und bei Kolja Blacher an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. 2016 gewann sie den Ersten Preis des Internationalen Carl-Nielsen-Violinwettbewerbs in Odense, Dänemark. Als Solistin trat sie mit Orchestern wie dem Philharmonia Orchestra, dem Orchestre National de Belgique, dem Orquesta de Valencia, dem Svenska Kammarorkestern und Sinfonieorchestern in Odense, Poznań, Indianapolis, Seoul und Gyeonggi auf. Darüber hinaus ist sie Teil des Boulez Ensembles und arbeitet dabei mit Künstlern wie Antonio Pappano, François-Xavier Roth, Jörg Widmann und Daniel Barenboim. Jiyoon Lee ist seit 2017 Erste Konzertmeisterin der Staatskapelle Berlin. Sie spielt eine Geige von Carlo Ferdinando Landolfi, die ihr die Deutsche Stiftung Musikleben zur Verfügung gestellt hat.
wurde in Tschechien geboren und studierte in Philadelphia am Curtis Institute of Music sowie an der Berliner Hochschule für Musik Hanns Eisler. Stark beeinflusst hat den Vorspieler der Ersten Violinen der Geiger Václav Hudeček, mit dem er oft gemeinsam Konzerte gibt. Bevor er 2018 ins Konzerthausorchester eintrat, war er drei Jahre lang Erster Konzertmeister des Orchesters der Komischen Oper Berlin. Er spielt außerdem im Konzerthaus Kammerorchester.
wurde in Fulda geboren und absolvierte sein Studium an der Universität der Künste Berlin. Seit 2018 ist er Mitglied im Konzerthausorchester Berlin und spielt außerdem im Konzerthaus Kammerorchester. Als Preisträger zahlreicher Wettbewerbe spielte er solistisch mit Orchestern wie den Göttinger Symphonikern, der Thüringischen Philharmonie oder der Philharmonie Südwestfalen und tritt regelmäßig kammermusikalisch bei großen Festivals auf. Andreas Feldmann ist Mitglied des aktuellen Orchestervorstands. Andreas Feldmann ist Mitglied des aktuellen Orchestervorstands.
Der Erste Preisträger des Internationalen Johannes-Brahms-Wettbewerbs und des Internationalen Anton-Rubinstein-Wettbewerbs nahm als begeisterter Kammermusiker an der Veranstaltung „Chamber Music Connects the World“ teil, bei der er mit Gidon Kremer, Christian Tetzlaff und Steven Isserlis an der Kronberg Academy auftrat. Außerdem musizierte er beim Seiji Ozawa International Chamber Music Festival, Tianjin Juilliard Chamber Music Festival, Ljubljana Music Festival und am Třeboňská Noctura Music Festival.
Kyungsik begann sein Studium in an der Korea National University of Arts und der Seoul National University bei Eun-sik Choi. Nach seinem Abschluss mit höchster Auszeichnung setzte er sein Studium an der Universität der Künste Berlin bei Hartmut Rohde fort. Sein Studium wird von der Hyundai Foundation und dem DAAD-Stipendium unterstützt.
wurde im türkischen Antalya geboren. Die Stellvertretende Solo-Bratscherin studierte in Leipzig bei Tatjana Masurenko, in Paris bei Jean Sulem und in Berlin bei Tabea Zimmermann an der Hochschule für Musik Hanns Eisler sowie aktuell an der Universität der Künste bei Hartmut Rohde. Seit 2019 ist sie Mitglied im Konzerthausorchester Berlin, außerdem spielt sie am Konzerthaus im Quartett Polaris. Sie war Stipendiatin der Kurt-Sanderling-Akademie des Konzerthausorchesters.
Nilay Özdemir war zu Gast beim Krzyzowa Kammermusik Festival und Stipendiatin verschiedener renommierter Akademien (Verbier Festival, Kronberg, Seiji Ozawa).
wurde in Boston geboren. Er besuchte zunächst die Walnut Hill Arts School und war von 1996 bis 2007 Stipendiat am Project STEP. 2007 erhielt er das Kravitz Stipendium, außerdem den „Jack Kent Cooke-Award“, ein Sonderpreis der nationalen Radiosendung From the Top. Er gastierte in zahlreichen öffentlichen Sendungen. Als Solist führte er Cellokonzerte mit namhaften amerikanischen Orchestern auf. Er gewann mehrere Preise, u. a. 2014 den Zweiten Preis des Enescu Wettbewerbs und 2009 den Ersten Preis beim Sphinx Wettbewerb. Kammermusikkonzerte mit international bekannten Musikern runden sein vielfältiges Repertoire ab.
studierte Cello und Gesang an der Sibelius-Akademie in seiner Heimatstadt Helsinki, danach Cello bei Frans Helmerson in Köln. Seit 2002 ist der Stellvertretende Solo-Cellist Mitglied des Konzerthausorchesters Berlin. Er verfolgt eine umfangreiche Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker, ist Sänger von „Tango Finlandés“ und hat für das schwedische Label „BIS“ aufgenommen.
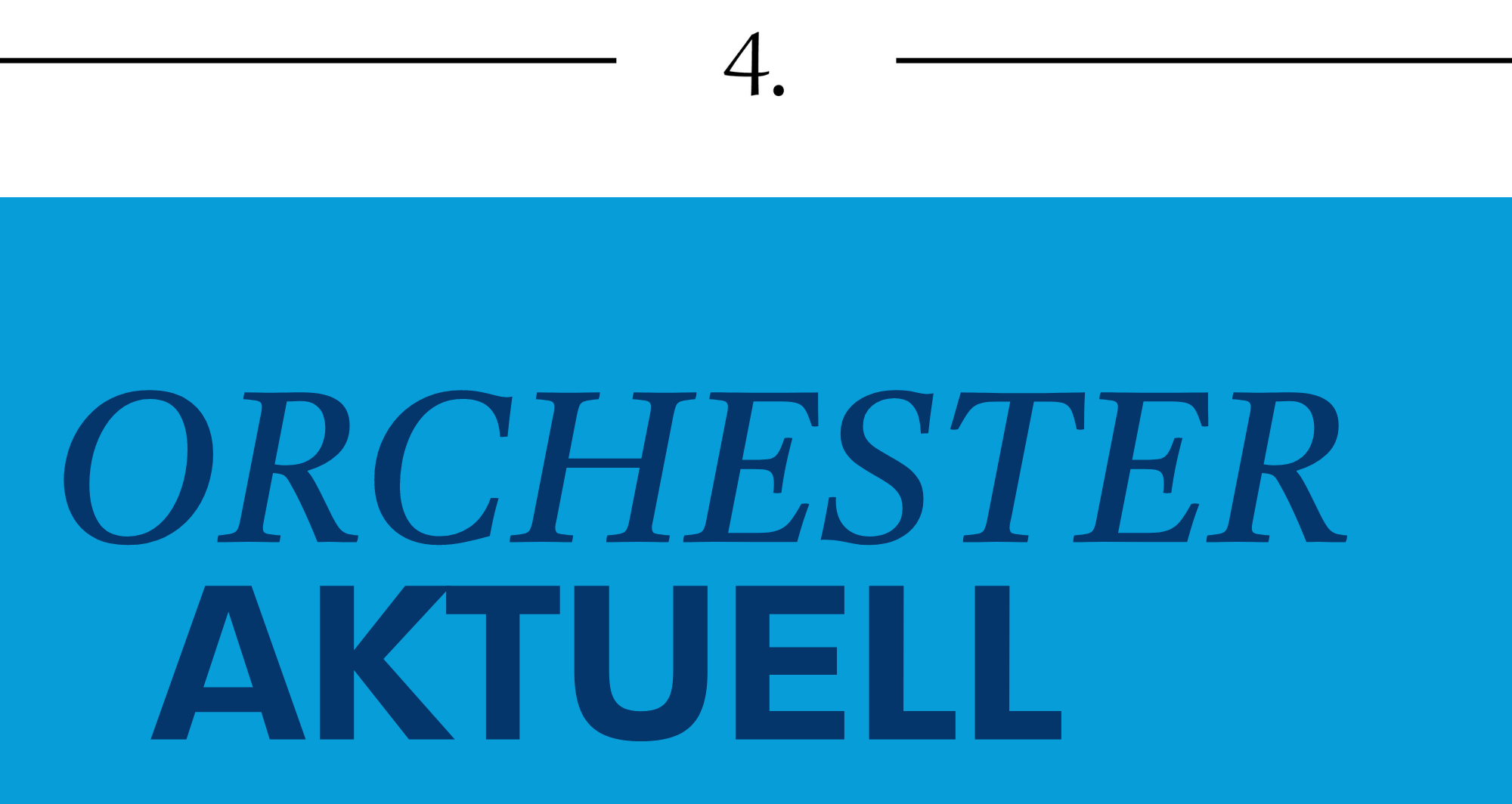

Bevor unser superlangsamer Aufzug Süd auf unbestimmte Zeit eine Renovierungspause einlegt und wir alle in die sommerliche Spielzeitpause starten, haben wir noch einen kleinen Rekord aufgestellt – für die (zumindest vorerst) letzte Folge hat er sich mit acht von zwölf aktuellen Stipendiatinnen & Stipendiaten unserer Orchesterakademie auf den Weg nach oben gemacht.
Unsere Fragen haben Flötist Giorgio Bani und Geiger David Navarro beantwortet – für die Antworten aller wäre selbst die Fahrt im Aufzug Süd nicht lang genug gewesen!