11.00 Uhr
cappella academica, Christiane Silber


Konzerthausorchester Berlin
Iván fischer Dirigent
Vocalconsort Berlin
deniz uzun Sarastra
Samuel Mariño König der Nacht
Programm
Richard Strauss (1864 – 1949)
„Der Bürger als Edelmann“ – Orchestersuite aus der Bühnenmusik nach Molière op. 60
Ouvertüre
Menuett
Der Fechtmeister
Auftritt und Tanz der Schneider
Das Menuett des Lully
Courante
Auftritt des Cleonte
Vorspiel zum 2. Aufzug
Das Diner
PAUSE
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Zauberflöte aktuell – eine Konfrontation mit der Gegenwart
Ouvertüre (Orchester und Chor)
Priestermarsch (Frauenchor)
O Isis und Osiris (Sarastra und Frauenchor)
Der Hölle Rache (König der Nacht)
O Isis und Osiris (Chor)
Finale (Sarastra und Chor)
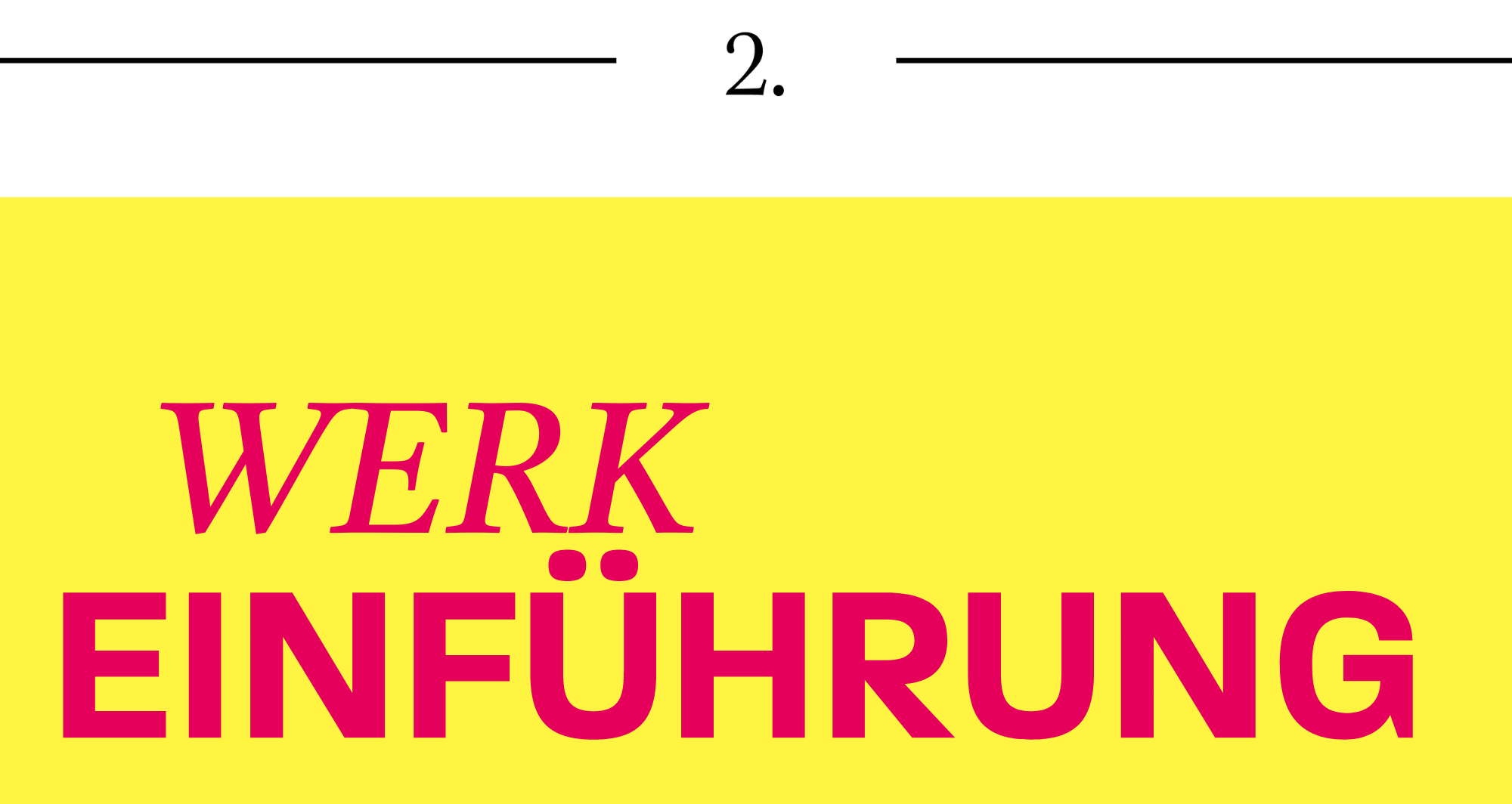
Der Bürger als Edelmann? Die Vorstellung ist charmant, nachgerade verführerisch. Eine Welt voller Kavaliere, die Damen generös den Vortritt gewähren, über allerbeste „Kniggesche“ (Tisch-)Manieren gebieten und auch im Umgang untereinander ein Höchstmaß an Anstand und gegenseitigem Respekt walten lassen.
Nun ist aber die Welt nicht ganz so ideal beschaffen, wie man es sich wünschen würde, und vor allem was den „Bourgeois gentilhomme“ betrifft, wie er, etwas eleganter und duftender, im Französischen heißt, klafft häufig mehr als nur ein synaptischer Spalt zwischen Idee, Ideal und Wirklichkeit. Einer, der dies erkannt hatte und es, zum großen Glück für die Nachwelt, in wunderbare Verse zu kleiden vermochte, war der dichtende Schauspieler Jean-Baptiste Poquelin, uns weithin vertrauter unter seinem Künstlernamen Moliére.
Auf das Klanggewand, das Richard Strauss dem „Bürger als Edelmann“ in seiner Suite schneiderte, lässt Iván Fischer eine weitere Suite folgen: eine Auswahl von Arien und Szenen aus Mozarts „Zauberflöte“. Und auch hier geht es um Sein und Schein, um (Moral-)Vorstellungen, überkommene Klischees, ebenso um neue Werte, Sichtweisen des 21. Jahrhunderts… Die Verkehrung von Geschlechterrollen und überraschende Schlaglichter auf die Musik laden zu allerlei Reflexionen und ungewohnten Hörerlebnissen.
Richard Strauss‘ „Der Bürger als Edelmann“


Dr. Richard Strauss, porträtiert 1919 in Berlin von Max Liebermann
Molière stellte den Bürger, der ein Citoyen nicht sein mochte, in seinen wortmächtigen, mit Esprit gesegneten Komödien nicht nur auf die Bühne, sondern meist auch hemmungslos bloß. Man denke nur an den unglücklich verliebten Misanthropen Alceste, der jede seiner Sottisen ernst meint, aber gerade damit nichts als Gelächter hervorruft, an Harpagon, den misogynen Geizkragen, oder an den eitlen Gockel Orgon, der gar nicht mitkriegt, wie Tartuffe ihn über den Tisch und durch den Kakao zieht. Sie alle kriegen ihr Fett weg. Und so auch jener Mann, der Goethes Postulat („Edel sei der Mensch, / Hülfreich und gut!“) in erster Linie auf sich selbst anwendet, entkommt Molières wortmächtig sprudelndem Spott nicht: der neureiche Tuchhändler Jourdain alias „Le Bourgeois gentilhomme“, dem sein plötzlicher Wohlstand so sehr zu Kopf gestiegen ist, dass er die Realität(en) nur noch sehr verschwommen wahrnimmt und, salopp gesagt, kräftig eins auf die Mütze kriegt.
Mit dem gleichnamigen, am 14. Oktober 1670 aus dem Taufbecken gehobenen Comédie-Ballet setzte ihm Molière ein bezaubernd-sarkastisches Denkmal. „Le cour et la ville“, sprich: Ludwig XIV., Teile seines Hofstaats sowie viele blaublütige Pariser Honoratioren waren gekommen, und sie waren angetan – vom Stück selbst wie von den delikat-distinkten Klängen, die Jean-Baptiste Lully, unumschränkter Musik-Titan im Reich des Sonnenkönigs, für die Komödie ersonnen hatte. Verwundern durfte die Begeisterung niemanden, schließlich war Molières und Lullys „Le Bourgeois gentilhomme“ als „Auftragswerk“ des Königs Teil jener glanzvollen höfischen Festivitäten, zu denen die Kunst lediglich das pittoreske Amüsier-Rankenwerk bildete.
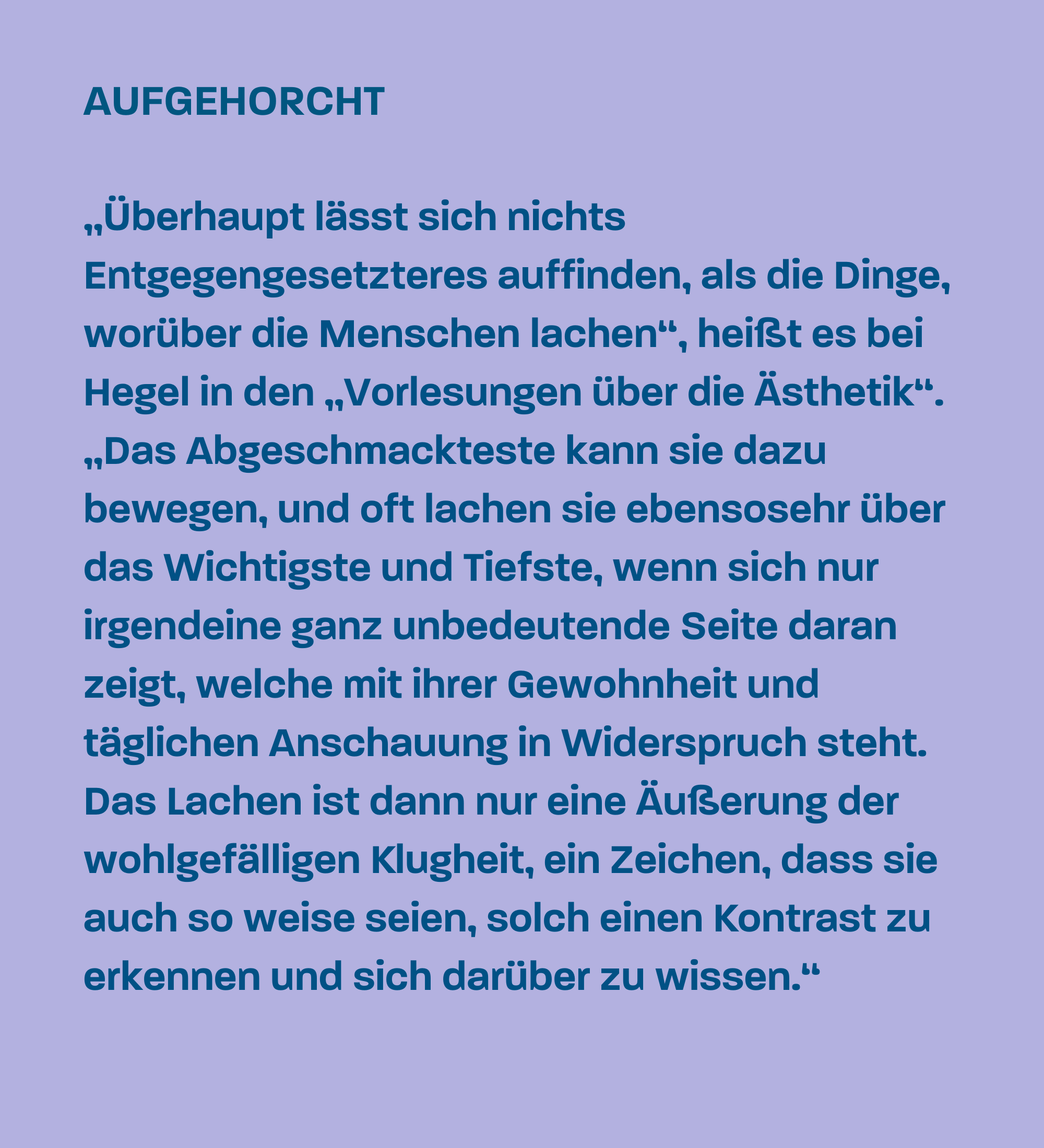
Rahmenhandlung zur Oper „Ariadne auf Naxos“
Knapp 250 Jahre später – der Absolutismus hatte sich längst verabschiedet, die Rolle der Kunst aber war nach wie vor in etwa die gleiche – entschlossen sich der Dichter Hugo von Hofmannsthal und der Komponist Richard Strauss anlässlich des 50. Geburtstags des renommierten Theatermachers Max Reinhardt zu einem musiktheatralischen Experiment, das auf Molières und Lullys Ballet-Comédie Bezug nahm: Molières „Le Bourgeois Gentilhomme“ wurde nun mit einer Schauspielmusik von Strauss versehen, die ihrerseits als Rahmenhandlung für die Oper „Ariadne auf Naxos“ dienen sollte. Kein einfaches Unterfangen. Die Uraufführung in Stuttgart war ein Misserfolg – französisches Schauspiel und „griechische“ Oper, das wollte zueinander kaum passen. Die beiden Autoren indes gaben ihr Projekt der Verschmelzung zweier Kunstformen trotz veritabler Widerstände nicht auf – das Werk wurde geteilt, erhielt den Titel „Oper in einem Aufzug nebst einem Vorspiel“ und wurde 1916 in Wien relativ erfolgreich auf die Bühne gebracht. Ein Jahr später schrieb Hofmannsthal den „Bürger als Edelmann“ in eine dramaturgisch plausible Burleske um, zu der ihm Strauss 17 Bühnenmusiken „lieferte“. Da diese Fassung 1918 in Berlin nur mäßigen Anklang fand, entschied sich der Komponist für eine weitere Variante: Er koppelte neun Stücke seiner Schauspielmusik aus und fasste sie zu einer Orchestersuite zusammen – ein kühnes, aber gelungenes Experiment auch dies, das bewies schon die Erstaufführung am 31. Januar 1920 in Wien.
Hommage der Heiterkeit
Die Suite kann als Hommage an Lully gehört werden, ist unter dem Strich aber lupenreiner Strauss; eine überaus geschickte Verknüpfung der Stile aus dem Geist des „Rosenkavaliers“, der 1911 auf die Bühne gelangt war. Durch viele Passagen schimmert die galante Atmosphäre des 17. Jahrhunderts hindurch, ohne aber auch nur in einem Takt eklektisch anzumuten. Strauss (be)nutzt die höfische Musik, um sein eigenes Idiom in dieses anmutig-aparte Geflecht aus Melodien und Arabesken hineinzuweben, vergisst darüber aber nicht die Handlung der zugrundeliegenden Komödie; das verdeutlicht schon die Ouvertüre, in der man das Personal buchstäblich durch den Salon flitzen und herumwuseln sieht, um den darauffolgenden Auftritt des „Titelhelden“ vorzubereiten (der dann in seiner Tölpelhaftigkeit stark an das Entrée des Baron von Ochs im Schlafgemach der Feldmarschallin von Werdenberg gemahnt). Nur: Es ist nicht mehr die Diener(innen)schaft des französischen Feudalzeitalters, es ist die „Bagagi“ Faninals, die wir aus dem „Rosenkavalier“ kennen.
Und das passt punktgenau: Denn was ist dieser Bürger anderes als ein Nachfahre von Monsieur Jourdain? Ein aufgeplusterter Emporkömmling, der vor lauter Selbstherrlichkeit nicht sieht, was um ihn herum geschieht. Strauss kleidet es in süffisante Töne; allein der gravitätisch-schleppende, protzig-behäbige Eintritt des „Bourgeois gentilhomme“ ist eine vortreffliche Parodie. Doch auch das Gegenbild, die Liebe zwischen Lucile, Jourdains Tochter, und dem hübschen Jüngling Cléonte (der dem verblendeten Hausherrn als türkischer Prinz „erscheint“), findet ihren Platz in dieser Suite: im Menuett etwa, das auf die Ouvertüre folgt und in dem ein Vogel (die Solo-Flöte) zarteste Arabesken über den Salontänzerinnen und -tänzern verstreut; im „Menuett des Lully“, das, in der Mitte der Suite verankert, als geneigte Reverenz von Strauss an die „alten“ Meister gelten darf; in der geschmeidig tänzelnden Courante mit dem schwärmerischen Liebesgesang der Solo-Violine; oder auch im „Auftritt des Cléonte“, der die eklatanten Unterschiede zwischen dessen ebenso würdevoller wie spielerischer Leichtigkeit und der (trompeten)deftigen Gute-Laune-Bräsigkeit des Gastgebers subtil in Töne setzt.
Das humorvollste, irrlichterndste (und mit zehn Minuten längste) Stück der Suite steht am Ende: „Diner“ ist es überschrieben und serviert neben einer Vielzahl an schillernden Tonmalereien unter anderem Zitate aus Wagners „Rheingold“ und barocken Vorbildern. Wie Strauss all dies miteinander verquickt, ohne je trivial zu wirken, nun, eben darin liegt die einsame, hohe (kammermusikalische) Kunst dieses Komponisten.
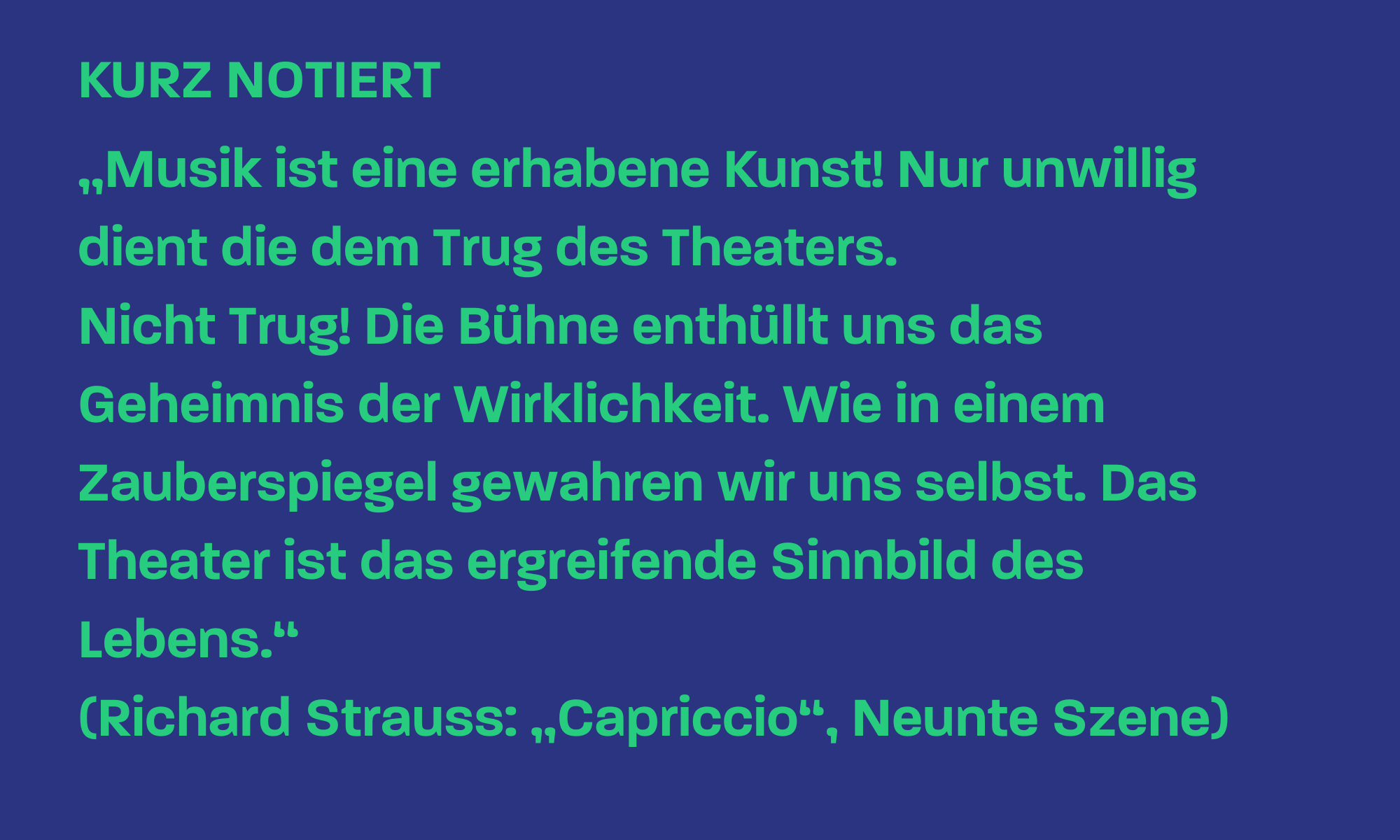 zurück
zurück
Wolfgang A. Mozarts „Die Zauberflöte“

Doch ist in dieser Musik von Strauss auch ein Hauch von Mozart zu spüren; ein Hauch von dessen Leichtigkeit, auch von dessen Unverfrorenheit, die sich ja selbst in einem bedeutungsschweren Werk wie der „Zauberflöte“ immer wieder Platz zu verschaffen vermag. Dem gegenüber aber steht der große, feierliche Ernst eines Singspiels, das bis heute nichts an seiner Popularität eingebüßt hat und auf den Spielplänen der Opernhäuser nach wie vor unangefochten den ersten Rang bekleidet. Womöglich liegt es an der Vieldeutigkeit dieser „deutschen Oper“ (Mozart); nicht zufällig hat der Literaturwissenschaftler Peter von Matt die „Zauberflöte“ einmal als „das dritte große Rätselwerk unserer Kultur“ neben Leonardo da Vincis „Mona Lisa“ und Shakespeares „Hamlet“ bezeichnet. In der Tat: Hoher Ton und niedere Gelüste treffen hier ebenso unvermittelt aufeinander wie andere, nicht minder schroffe Gegensätze: Dur und Moll, Licht und Dunkel, Glaube und Unglaube, Verzeihen und Rache, Gut und Böse, Spektakel und Geheimnis. Es ist eigentlich alles Menschliche, Allzumenschliche enthalten in diesem Werk der Widersprüche und des (mythischen wie christlichen) Manichäismus, das man sehr wohl auch als ein „Pasticcio aus komödiantischem Volkstheater, moralischem Lehrstück und freimaurerisch gefärbtem Einweihungsritual“ (Stefan Kunze) verstehen kann.

Singspiel ohne mythischen Schleier?
Für diverse Deutungen steht es offen; das hat erst vor wenigen Monaten der renommierte Musikwissenschaftler Laurenz Lütteken bewiesen, als er die „Zauberflöte“ in seinem neuen Buch ihres mythologischen und mystischen Schleiers beraubte und das Singspiel vor dem Hintergrund seiner Entstehung las: dem Epochenbruch der Französischen Revolution und ihrer Zuspitzung in einer Krise des österreichischen Sonderwegs der „von oben“ gesteuerten Aufklärung, die mit dem Tod des österreichischen Kaisers Joseph II. im Februar 1790, also ein Jahr vor der Uraufführung der „Zauberflöte“, ihr Ende fand. Eine mehr als diskutable Sichtweise.
Populärere Bestrebungen gehen in eine andere Richtung: So versuchte vor wenigen Monaten die Initiative „Critical Classics“ die Figuren der „Zauberflöte“ in einen neuen gesellschaftlichen Kontext zu stellen – mit dem erklärten Ziel, „ein generelles Bewusstsein für diskriminierende Sprache in Opernlibretti zu wecken und anhand praktischer Beispiele eine Diskussion anzuregen, wie mit problematischen Inhalten umgegangen werden kann“. In dieser „kritischen“, ihrem Wesen nach ebenso spektakulären wie spekulativen Neu-Edition erhielt Pamina eine zusätzliche Arie (natürlich von Mozart, aber mit gänzlich neuem Text), wurde der dummdreiste „Mohr“ Monostatos zum ehelichen Sohn Sarastros und mutierte „die wegen ihres Alters ausgelachte“ Papagena zur „starken Amazone“. Natürlich lässt sich über solche Eingriffe trefflich streiten …

Konfrontiert mit der Gegenwart
Einen dritten Weg beschreitet Iván Fischer. Er kredenzt das Singspiel als eines, das „von Vorurteilen befreit“ ist, gleichsam unter umgekehrten Vorzeichen – „Zauberflöte aktuell – eine Konfrontation mit der Gegenwart“ lautet der Titel seines ambitionierten Projekts mit dem Konzerthausorchester Berlin, der Altistin Gerhild Romberger und dem Counter Samuel Mariño sowie dem Vocalconsort Berlin, Überraschungen inklusive: Sarastro ist nunmehr eine Frau (Sarastra); seine Gegenspielerin sieht sich in einen „König der Nacht“ verwandelt, allerdings in einen, der als Sopranist höchste Lagen zu erklimmen vermag. Und die Mitglieder des Vocalconsorts wirken, obwohl Mozart für die Ouvertüre nicht einmal in seinen kühnsten Träumen einen Chor vorgesehen hätte, bei eben diesem Entrée entscheidend mit.
Die Ambivalenzen der „Zauberflöte“ sind dadurch nicht aufgehoben, aber einige tradierte Klischees werden befragt. Was bleibt, ist die Musik selbst: das numinose Es-Dur zu Beginn wie im würdevoll-versöhnlichen Finale; die Erhabenheit und der immense Erfindungsreichtum vieler Passagen; schließlich die unvergleichliche Wirkmächtigkeit der zentralen Arien. Wolfgang Amadé Mozart eben. Das Genie. Oder, um eine triftige Charakterisierung Hanns Eislers aufzugreifen: „der Komponist der Aufklärung“ – und wenn schon kein Bürger (Mozart war durch und durch Bohémien), so doch ganz gewiss ein Edelmann der tönend bewegten Form.
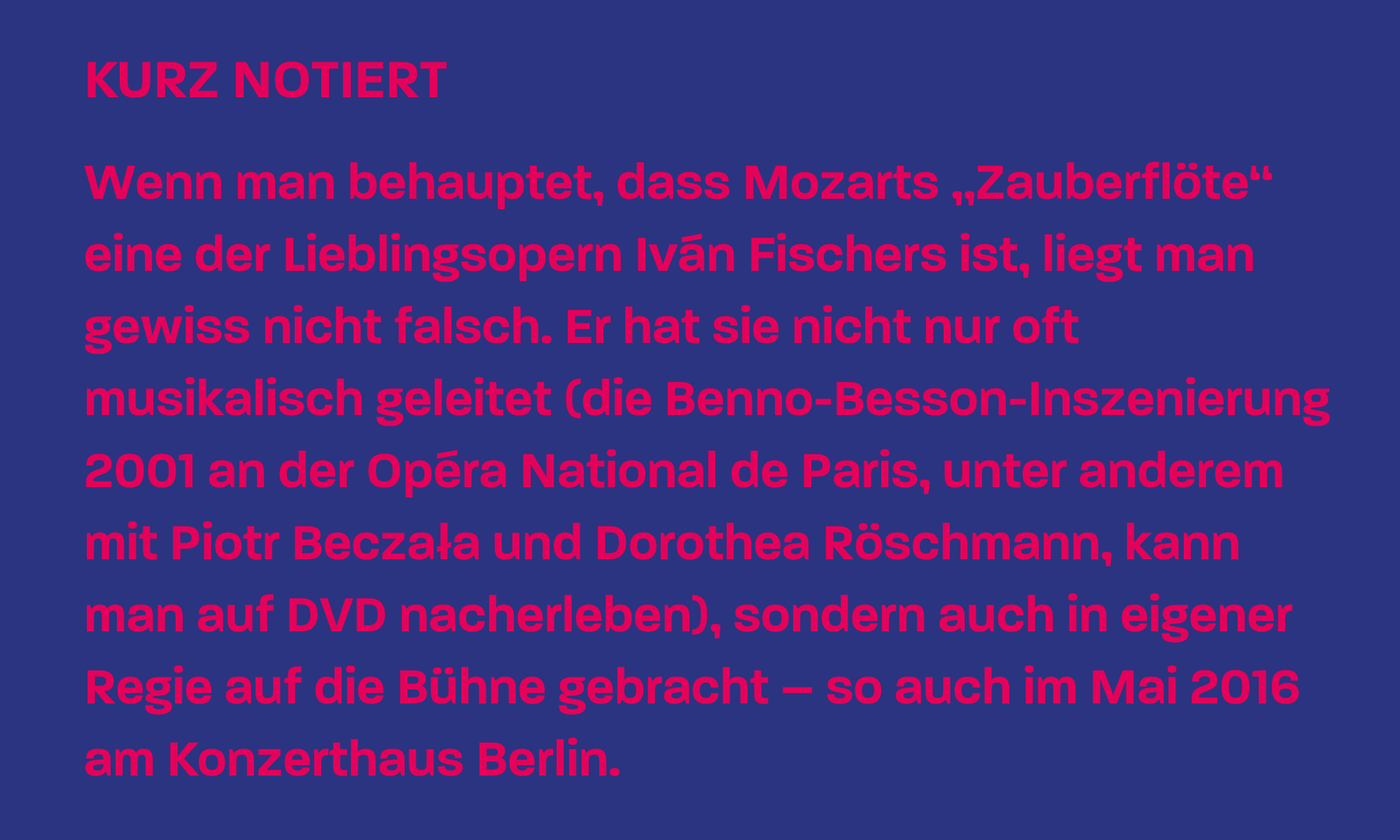



Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.
1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.
Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Iván Fischer ist als einer der visionärsten Musiker unserer Zeit bekannt. Er wirkt als Dirigent, Komponist, Opernregisseur, Denker, Vermittler - verankert in der Tradition der musikalischen Universalgelehrten. Sein Fokus ist stets die Musik, dafür entwickelte er zahlreiche neue Konzertformate und erneuerte die Struktur und die Arbeitsweise des klassischen Symphonieorchesters. Mit dem Budapest Festival Orchestra, das er Mitte der 80er Jahre gründete, hat er zahlreiche Reformen eingeführt und etabliert.
Weltweit wird Iván Fischer als einer der visionärsten und erfolgreichsten Orchesterleiter geschätzt. Von 2012 bis 2018 war er über sechs Spielzeiten hinweg Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin, das ihn zum Ehrendirigenten auf Lebenszeit ernannt hat. Als Gastdirigent konzertiert er mit den renommiertesten Sinfonieorchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Concertgebouworkest Amsterdam und dem New York Philharmonic. Fischer ist Gründer der Ungarischen Mahler-Gesellschaft und Schirmherr der Britischen Kodály Academy. 2020 wurde der Musiker zum Ehrengastdirigenten des Concertgebouworkest ernannt. Er ist Ehrenbürger von Budapest.
Der 1951 in Budapest geborene Fischer studierte Klavier, Violine und Violoncello in seiner Heimatstadt, ehe er in Wien die legendäre Dirigierklasse von Hans Swarowsky besuchte. Nach einer zweijährigen Assistenzzeit bei Nikolaus Harnoncourt startete er seine internationale Karriere mit dem Sieg beim Dirigentenwettbewerb der Rupert Foundation in London.
Seit 2004 ist Iván Fischer auch als Komponist tätig, er schreibt meist vokale Musik mit kleinen Instrumentalensembles. Seine Oper „Die Rote Färse“ hat in der ganzen Welt für Schlagzeilen gesorgt; die Kinderoper „Der Grüffelo“ erlebte in Berlin mehrere Wiederaufnahmen. Sein erfolgreichstes Werk „Eine Deutsch-Jiddische Kantate“ wurde in zahlreichen Ländern aufgeführt und aufgenommen.

Das Vocalconsort Berlin gilt als eines der besten Vokalensembles Deutschlands. 2003 gegründet, arbeitet der Chor mit unterschiedlichen Dirigenten, aber auch mit festen künstlerischen Partnern wie Daniel Reuss, Folkert Uhde und Sasha Waltz zusammen.
Das Vocalconsort Berlin ist regelmäßig in den Musikmetropolen und auf den großen Festivals Europas präsent. Wandlungsfähig in der Besetzung, reicht das Repertoire des Ensembles von Alter Musik bis hin zu zeitgenössischen Werken. Es feiert mit seiner beeindruckenden Homogenität Erfolge sowohl in a cappella-Aufführungen als auch in szenischen Produktionen wie Glucks Oper „Orfeo ed Euridice“, mit denen es bewusst die Grenzen der klassischen Genres und Disziplinen überschreitet.
Das Vocalconsort Berlin arbeitete bereits mit Dirigenten wie René Jacobs, Kent Nagano, Peter Ruzicka, Sir Simon Rattle, Marcus Creed, Jos van Immerseel, Pablo Heras-Casado, Christophe Rousset und Vladimir Jurowski zusammen. In den letzten Jahren intensivierte sich zudem die Zusammenarbeit mit dem Konzerthausorchester Berlin, der Staatsoper Unter den Linden sowie der Komischen Oper Berlin.

Deniz Uzun gab ihr erstes Konzert im Alter von sechs Jahren. Geboren in Mannheim und von klein auf unterstützt, fanden ihre Auftritte regelmäßig sowohl auf der Opernbühne als auch bei Konzertveranstaltungen im In- und Ausland statt. Ihr Lied- und Konzertstudium absolvierte sie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim bei Snezana Stamenkovic. Die Mezzosopranistin arbeitet seit 2013 mit Oylun Erdayi an ihrer stimmlichen Entwicklung. Während ihrer College-Jahre ermöglichten die Friedrich-Ebert-Stiftung und ein Stipendium der Georgina Joshi Foundation ihr ein Studium an der Jacobs School of Music in Bloomington, Indiana. Dort erhielt sie ein künstlerisches Diplom unter der Leitung von Carol Vaness im Jahr 2015. Weitere Impulse erhielt sie an der „Internationalen Meistersinger Akademie“ in Nürnberg unter der Leitung von Edith Wiens.
In der Saison 22/23 wurde Deniz Uzun Mitglied des Ensembles der Komischen Oper Berlin. Ebenso ist sie eine leidenschaftliche Konzert- und Liedsängerin und gab 2023 beim Festival Capuchos in Portugal zusammen mit dem Pianisten David Santos mehrere Konzerte. In der Saison 23/24 sang sie beim Dallas Symphony Orchestra Fricka und Waltraute im „Ring“-Zyklus unter Leitung von Fabio Luisi – die erste halbszenische Konzertversion in der US-Geschichte – sowie Olga in der Barrie Kosky-Inszenierung von „Eugen Onegin“ an der Komischen Oper Berlin. Deniz gab ihr Rollen- und Hausdebüt bei der Saisoneröffnung des Teatro Lirico di Cagliari als Rubria in Boitos selten aufgeführter Oper „Nerone“ unter der Leitung von Francesco Cilluffo gab Konzerte mit den Berliner Philharmonikern, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und dem Leipziger Gewandhausorchester. Die aktuelle Saison begann für sie mit Ravels „Shéhérazade“ in Budapest mit dem MÁV Orchestra unter Leitung von Robert Farkas und mit einer Rückkehr zum Dallas Symphony Orchestra, erneut als Fricka und Waltraute. Weiterhin im Kalender stehen ihr Debüt beim Orchestra Sinfonia di Milano in Verdis „Messa da Requiem“ unter der Leitung von Michele Gamba, Rollen- und Hausdebüts wie Polina in „Pique Dame“ am Teatro Regio di Torino, der Mère Marie de L’Incarnation in „Dialogues des Carmelites“ am Teatro la Fenice und der Maddalena in „Rigoletto“ sowie der Flora in „La Traviata“ bei den Tiroler Festspielen Erl.
Deniz Uzun wurde bei mehreren nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Zuletzt gewann sie den Ersten Preis beim Elizabeth Connel 2022 International Singing Competition, 2021 den Éva Marton Prize bei der 4. Ausgabe des Eva Marton International Singing Competition sowie den Elena Obraszova Prize beim Tenor Viñas Competition in Barcelona, Spanien. 2018 gewann Deniz drei Sonderpreise beim Belvedere Competition, und 2015 stand sie im großen Finale der Metropolitan National Council Auditions in New York City. Als erste türkischstämmige Teilnehmerin im Finale des Wettbewerbs wurde sie 2016 in Istanbul von der Semiha Berksoy Foundation mit dem Preis „Best Young Singer“ und von der Académie Nationale du Disque Lyrique in Paris mit dem „Leyla Gencer Prize (Golden Orphée)“ ausgezeichnet.

Geboren 1993 in Venezuela, studierte Samuel Mariño zuerst Klavier und Gesang am Nationalkonservatorium von Caracas und nahm zugleich Ballettunterricht. Seine ersten Opernerfahrungen sammelte er in seiner Heimat mit der Camerata Barocca und Dirigenten wie Gustavo Dudamel, Helmuth Rilling und Theodore Kuchar, die sein besonderes Interesse an Barockmusik weckten. Nach weiteren Studien am Konservatorium von Paris hat sich Samuel Mariño bereits ein weites Repertoire erschlossen, mit Opern des Barock und der Klassik von Monteverdi über Händel, Porpora und Vivaldi bis zu Mozart und Salieri. Nach dem Gewinn des Publikumspreises beim Wettbewerb „Neue Stimmen“ in Gütersloh debütierte der Sänger 2018 bei den Händel-Festspielen in Halle als Alessandro in der Oper „Berenice“.
Auftritte in den vergangenen Spielzeiten reichten von Bachs h-Moll-Messe in Budapest und Glucks „Antigono“ im Markgräflichen Theater Bayreuth bis zu Cimarosas „Gli orazi e i curiazi“ bei den Musikfestspielen Schloss Rheinsberg. Seine vokale Flexibilität und der weite Umfang seiner Stimme ermöglichen es Samuel Mariño außerdem, auch Belcanto-Rollen des 19. Jahrhunderts wie den Romeo in Bellinis „I Capuleti e i Montecchi“ und Arsace in Rossinis „Aureliano in Palmira“ sowie den Oscar in Verdis „Ballo in maschera“ zu singen.
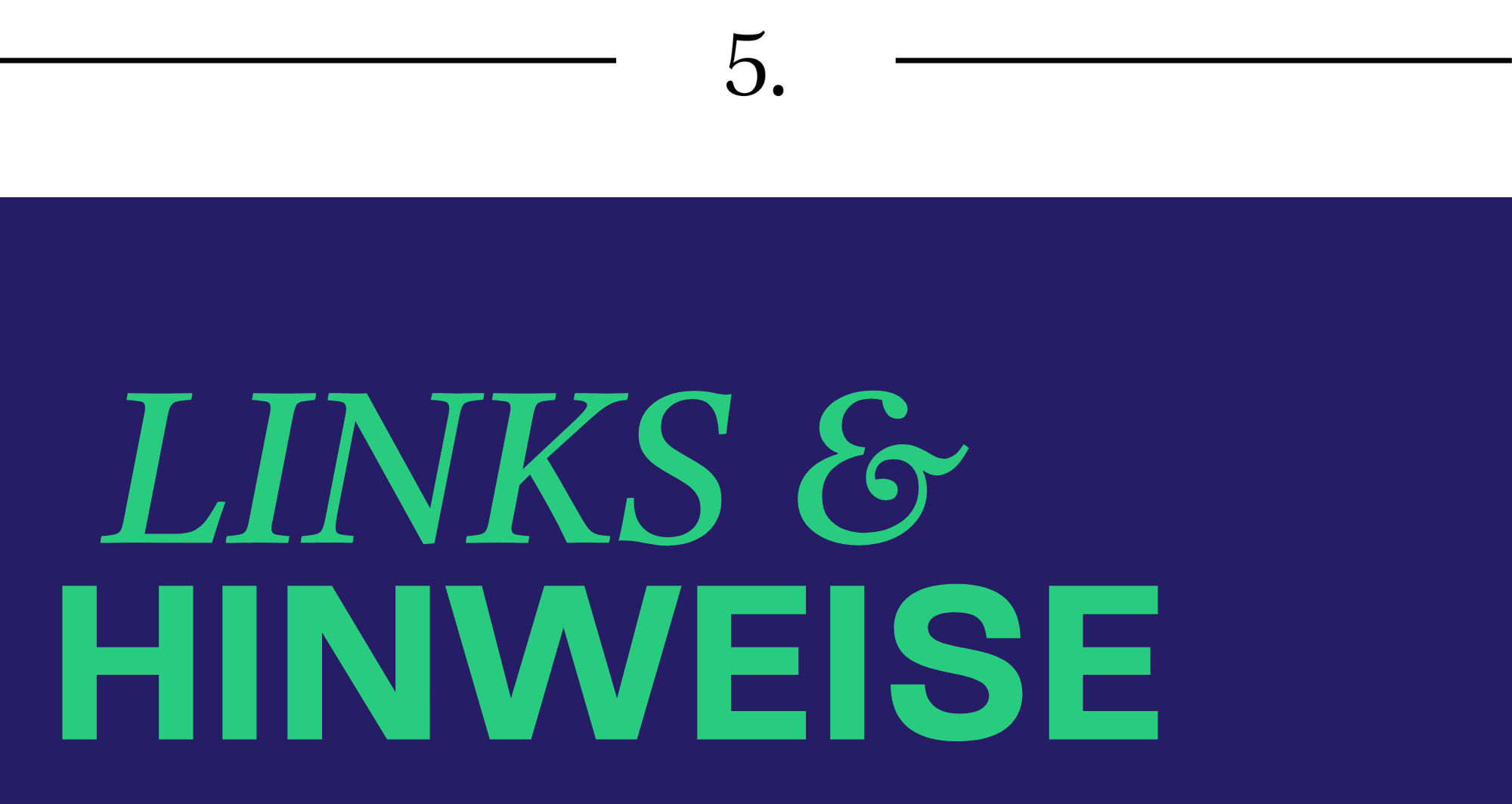
Mozart's “Magic Flute” is a masterpiece of the 18th century that reflects the moral concepts of the time with regard to the roles of men and women. Iván Fischer wants to confront parts of this favorite opera with 21st century values. He concentrates on well-known arias and scenes: Reversed gender roles of central characters invite an unexpected new listening experience as well as reflection: Counter tenor Samuel Mariño appears as the antagonist of Deniz Uzun's Sarastra. But Iván Fischer also plays with the music itself, for example when he has the famous overture performed not only by the Konzerthausorchester but also by the Vocalconsort Berlin.
We asked him a couple of questions about his approach.