11.00 Uhr
cappella academica, Christiane Silber

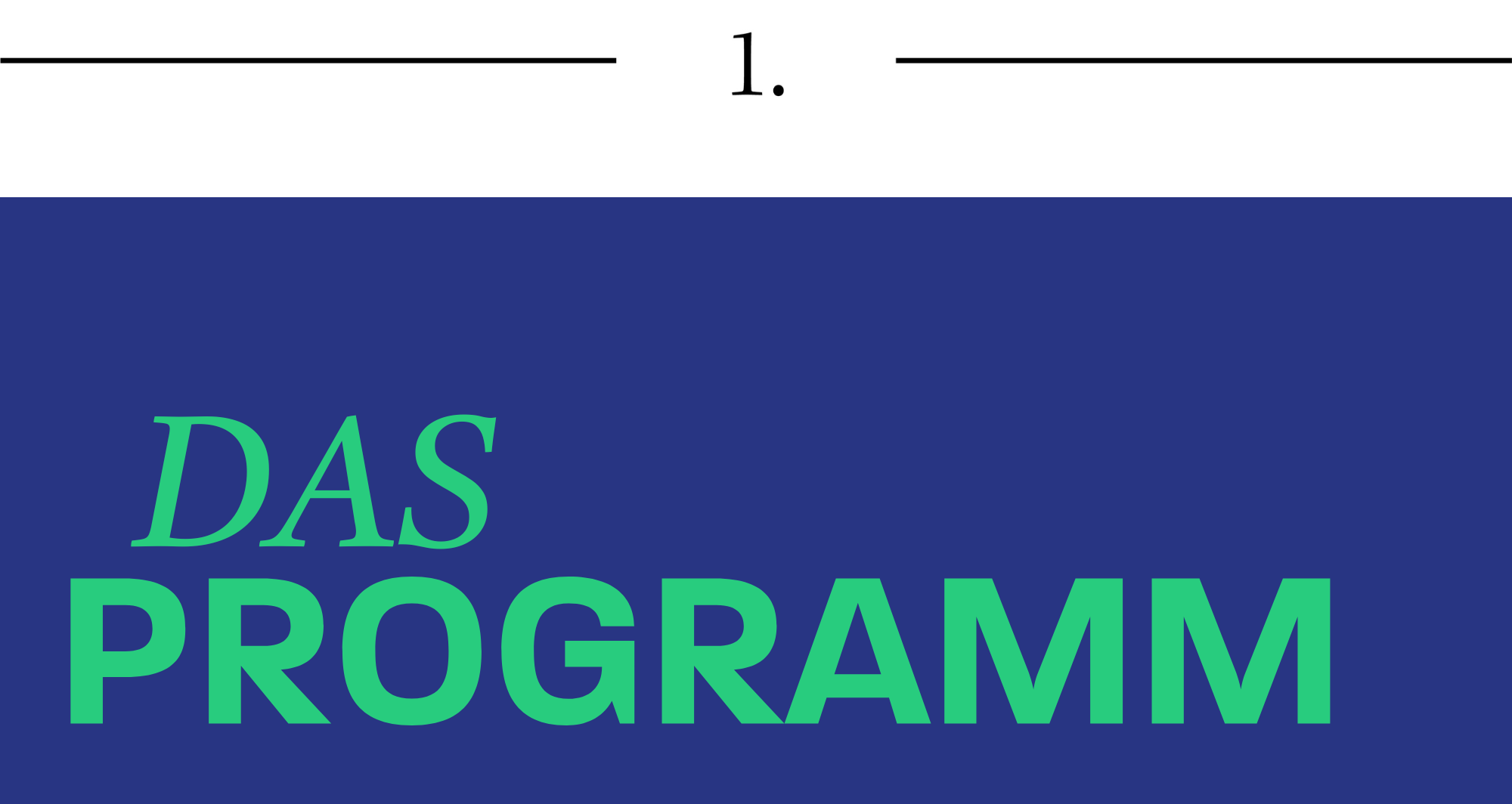
Konzert zugunsten der Kurt-Sanderling-Akademie des Konzerthausorchesters Berlin
Konzerthausorchester Berlin
Joana Mallwitz Dirigentin
Mitglieder der Kurt-Sanderling-Akademie des Konzerthausorchesters Berlin
Veronika Kahrer Violine
Giorgio Bani Flöte
Sunghyun Jang Viola
Fabian Sturm Violoncello
Tigran Mirzoian Schlagzeug
Felix Korinth Moderation
Programm
Johannes Brahms (1833 – 1897)
„Akademische Festouvertüre“ c-Moll op. 80
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Oktett für vier Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli Es-Dur op. 20
Allegro moderato ma con fuoco
Andante
Scherzo. Allegro leggierissimo
Presto
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Ouvertüre zur Oper „Le nozze di Figaro“ KV 492, für Kammerensemble bearbeitet von Felix Korinth
PAUSE
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67
Allegro con brio
Andante con moto
Allegro
Allegro
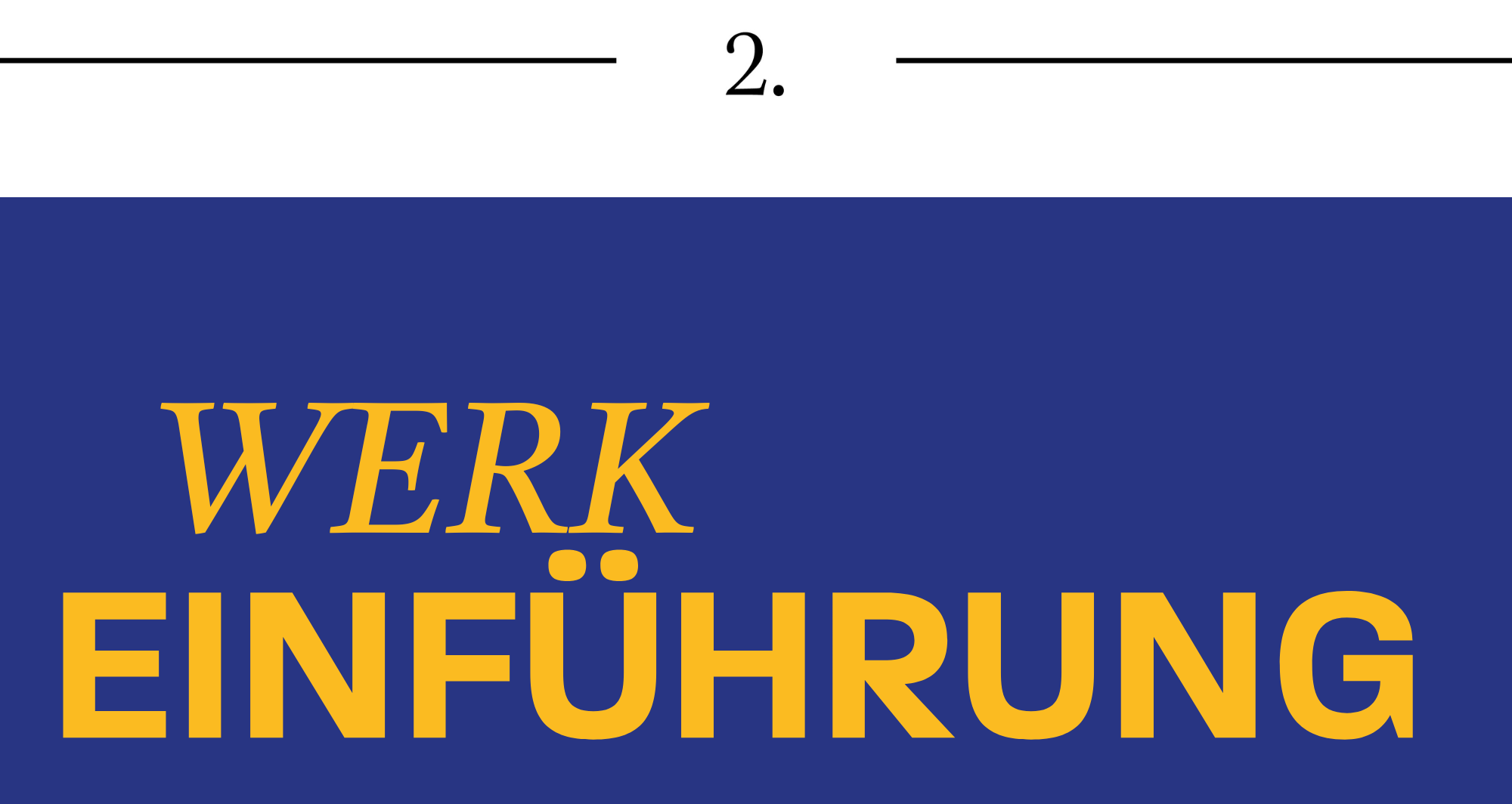
Liebes Publikum, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Orchesterakademie,
auf dieses Konzert freue ich mich ganz besonders, denn heute wollen wir die Kurt-Sanderling-Akademie feiern und hochleben lassen mit Ihnen, unserem Konzerthausorchester und natürlich allen Mitgliedern unserer Orchesterakademie!
Ganz im Geiste des Namensgebers, dem langjährigen Chefdirigenten Kurt Sanderling, können wir jedes Jahr jungen Musikerinnen und Musikern eine lebendige musikalische Ausbildung geben und sie auf dem Weg in ein großes Sinfonieorchester begleiten.
Zusätzlich zur technischen Exzellenz und Virtuosität, die jedes Mitglied unserer Akademie selbstverständlich mitbringen muss, gibt es so viele aufs Orchesterspiel ausgerichtete Bausteine des Musizierens, die man unbedingt in der Praxis erfahren und in der Orchesterarbeit lernen und weiterentwickeln muss.
Dabei werden die neuen Akademistinnen und Akademisten von ihren Mentorinnen und Mentoren aus unserem Orchester eng betreut und intensiv in ihrer musikalischen Entwicklung im Orchester begleitet und unterstützt. Besonders schön ist es zu sehen, wie lange und nachhaltig die Orchesterakademie mit dem Haus und dem Orchester verbunden ist und wie viele unserer bisherigen Akademistinnen und Akademisten mittlerweile ihren Weg zu festen Positionen in herausragenden Orchestern gefunden haben.
Für mich als Chefdirigentin ist es wunderbar, diese jungen Musikerinnen und Musiker im Orchester zu erleben, ihren frischen Wind und ihre Bereitschaft, alles zu geben für die Musik, und unsere Konzerte bis hin zu unseren großen Abokonzerten mitzutragen und mitzugestalten.
In diesem Sinne: Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und ganz viel Freude bei diesem Konzert!
Ihre
Joana Mallwitz

„Akademische Festouvertüre“ c-Moll op. 80
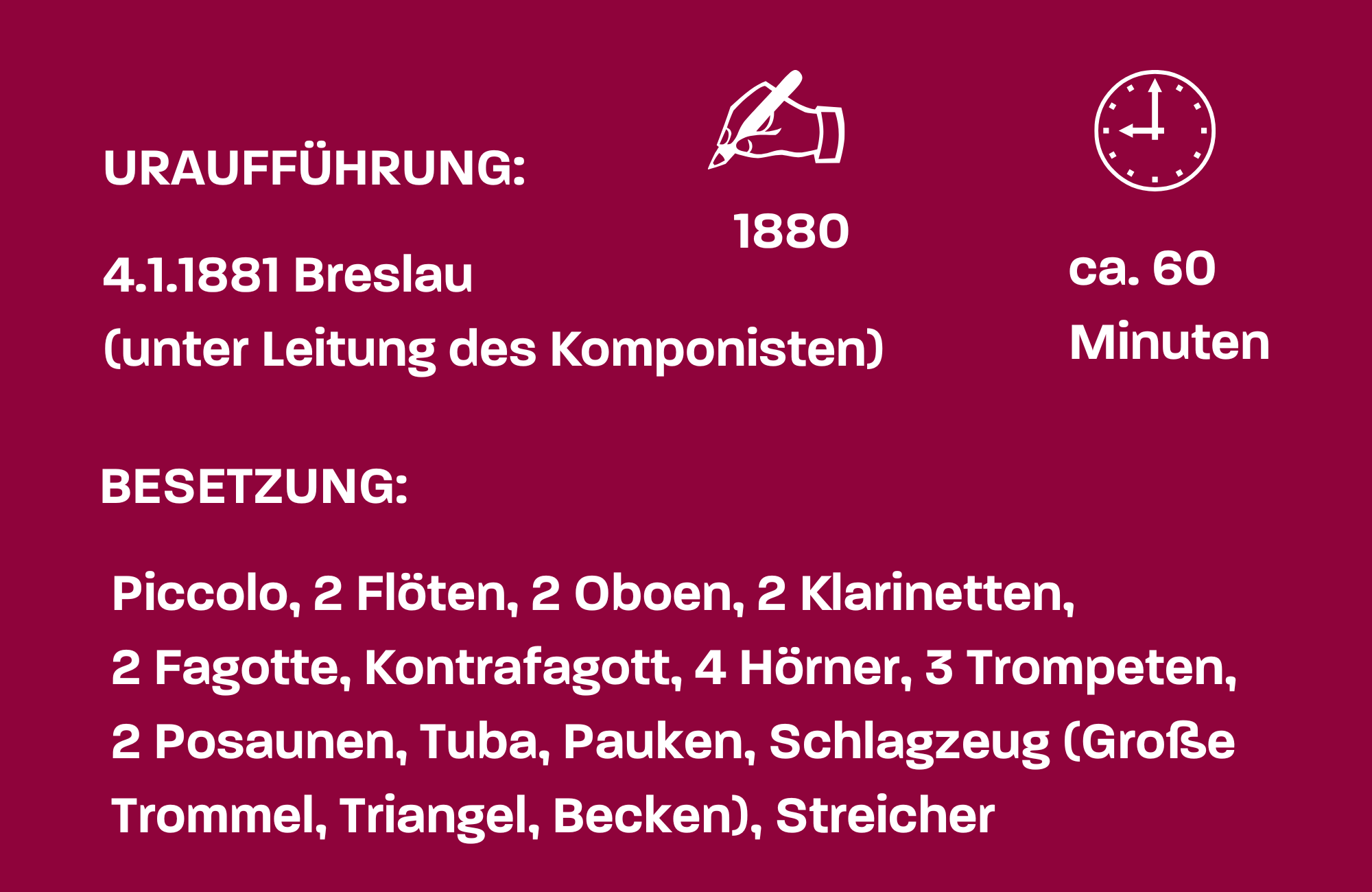
Im Jahre 1880 komponierte Johannes Brahms in der Sommerfrische von Bad Ischl zwei Ouvertüren für Orchester. „Die eine weint, die andere lacht“, hatte der Komponist am 7.10.1880 an Carl Reinecke nach Leipzig geschrieben und damit zum Ausdruck gebracht, dass er die beiden Ouvertüren op. 80 und op. 81 als ein zusammengehöriges Opus ansah, als zwei Seiten einer Medaille. Aus praktischen Erwägungen entschloss er sich dann jedoch, die beiden Orchesterstücke als Einzelwerke in Druck zu geben. Dieses Denken in komplementären „Werkpaaren“ tritt bei Brahms häufiger auf – so etwa im Falle der beiden Orchesterserenaden, der ersten beiden Sinfonien, der zwei Streichquartette op. 51 oder der späten Klarinettensonaten.

Entstehungsanlass für die „Akademische Festouvertüre“ op. 80 war Brahms’ im Jahre 1879 ausgesprochene Ehrenpromotion durch die Universität Breslau, für die sich der Komponist nicht mit einer Rede bedankte, sondern mit einer neuen Komposition, die zunächst wie eine muntere Folge von mehr oder weniger bekannten Studentenliedern daherkommt, der ehrenden Fakultät huldigte. Als ernstzunehmender Tonsetzer beließ es Brahms natürlich nicht bei einem Potpourri, sondern unterwarf die Liedweisen – bis auf das für den Schluss aufgesparte „Gaudeamus igitur“ – einer komplexen sinfonischen Verarbeitung und Durchdringung.
Den ihm 1876 angebotenen Ehrendoktortitel der Universität Cambridge hatte Brahms nicht annehmen können, weil er die Mühen der weiten Reise dorthin scheute. Zum Glück war die Entfernung von Wien nach Breslau überschaubar, und dies sicherte uns eines der köstlichsten und wohl auch humorvollsten Werke von Brahms!
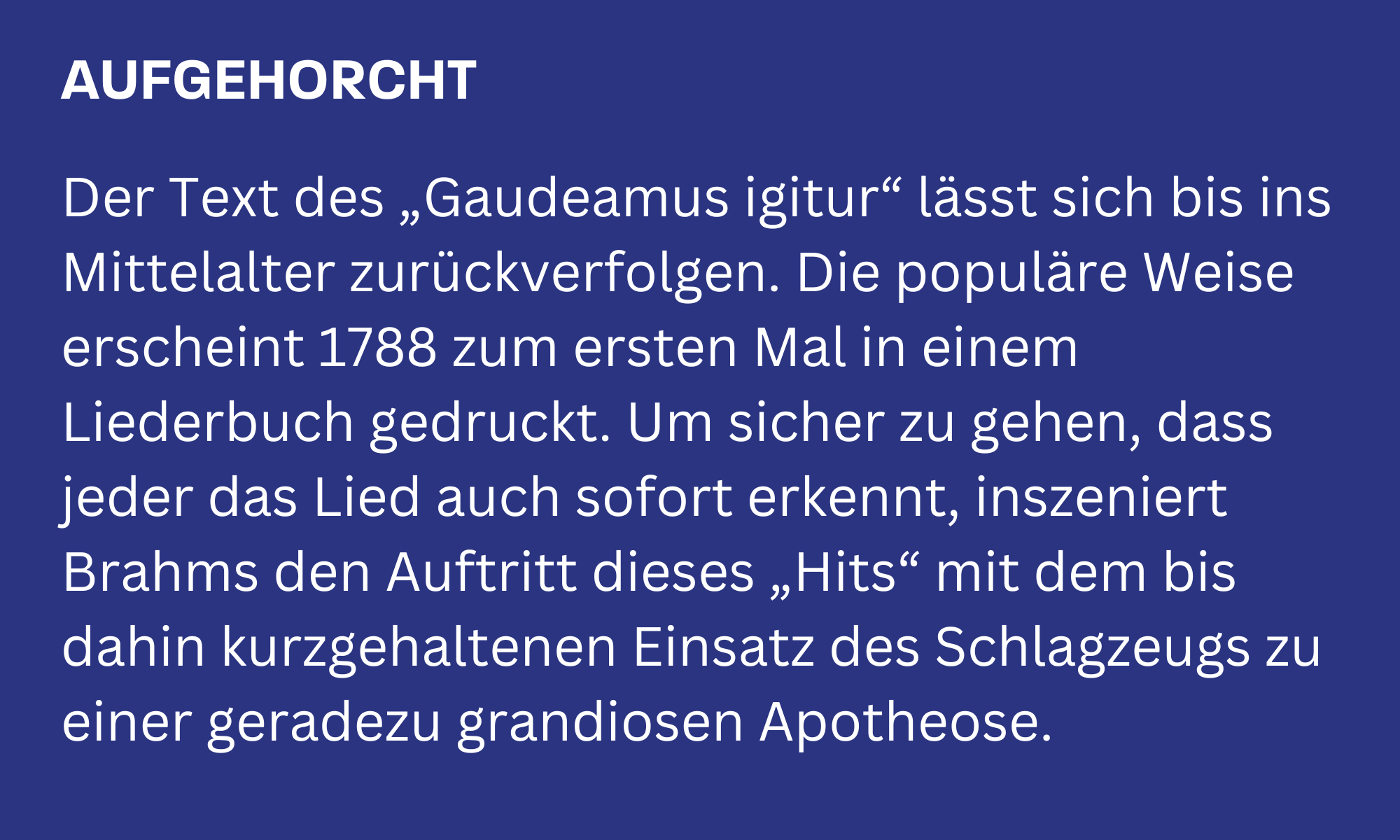
Oktett Es-Dur op. 20
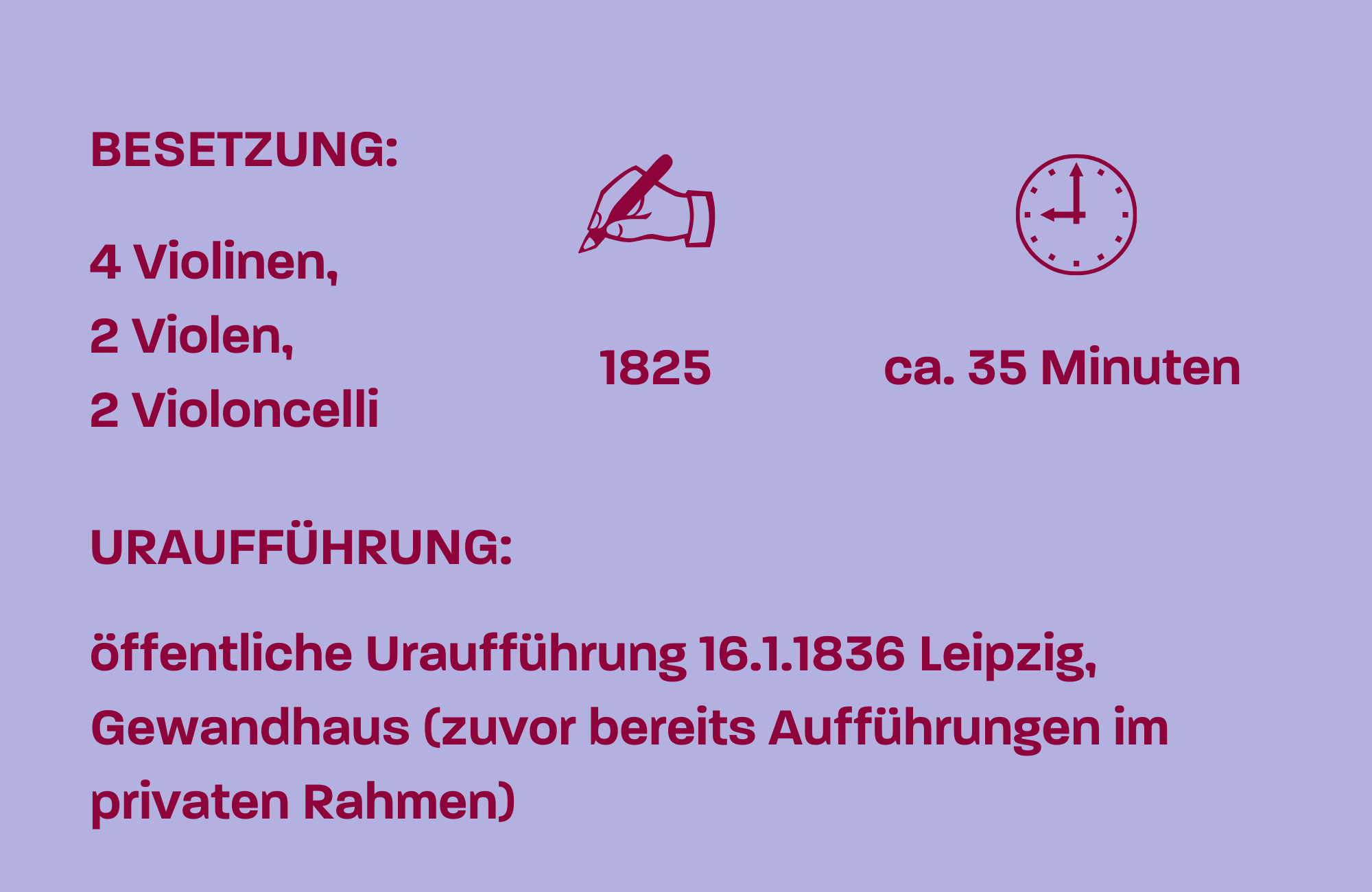
1809 in Hamburg geboren, war Felix Mendelssohn Bartholdy ab 1811 in Berlin eine glückliche und sorgenfreie Kindheit vergönnt. Der Vater, als Inhaber eines florierenden Geldinstitutes sehr vermögend, verstand es, die besten Lehrer, die Berlin nur bieten konnte, mit der Erziehung seiner Kinder zu betrauen. So erhielt der begabte Schüler Unterweisung durch Ludwig Berger (Klavier), Eduard Rietz (Violine) und Carl Friedrich Zelter (Komposition), zeitweise genoss er den Unterricht des berühmten Pianisten Johann Nepomuk Hummel, der seinerseits einst Mozarts Schüler war.
Verständlicherweise hielt sich der junge Komponist zunächst eng an seine stilistischen Vorbilder – und es zeugt für die Qualität seiner Ausbildung und für sein früh entwickeltes Selbstbewusstsein, dass er sich dafür stets die besten und prominentesten Muster aussuchte: Händel und Bach, Hummel und Beethoven, Carl Philipp Emanuel Bach und Mozart …

Mit den ersten Takten des 1825 entstandenen Oktetts für vier Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli Es-Dur hat der Hörer keine Veranlassung mehr, nach irgendwelchen Vorbildern zu fahnden: Neben der „Sommernachtstraum“-Ouvertüre gilt das Oktett als das erste Meisterwerk, in dem sich Mendelssohns Stil in seiner Eigentümlichkeit Bahn bricht. Im Gegensatz zu den fast gleichzeitig entstandenen Streicheroktetten von Louis Spohr, die eigentlich Doppelquartette sind (d. h. dass sich in ihnen zwei Streichquartette gegenüberstehen bzw. -sitzen), ist Mendelssohns op. 20 ein echtes Oktett, das durchaus sinfonischen Geist atmet. Das Scherzo kreiert geradezu einen neuen Stil – Kompositionen „nach Elfenart“ werden bald ein Markenzeichen von Mendelssohns Stil und Schaffen werden ...
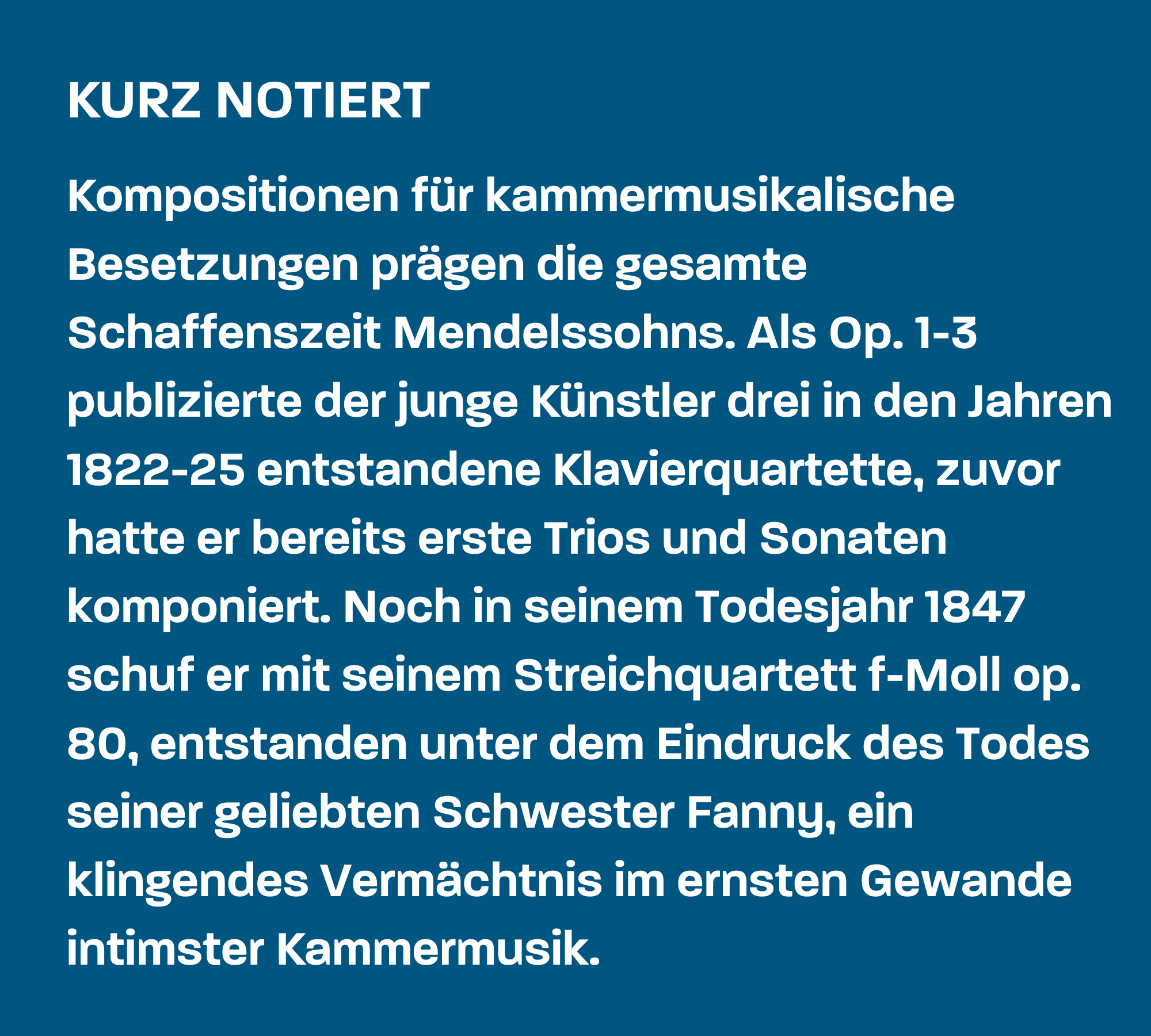
Ouvertüre zur Oper „Le nozze di Figaro“ KV 492
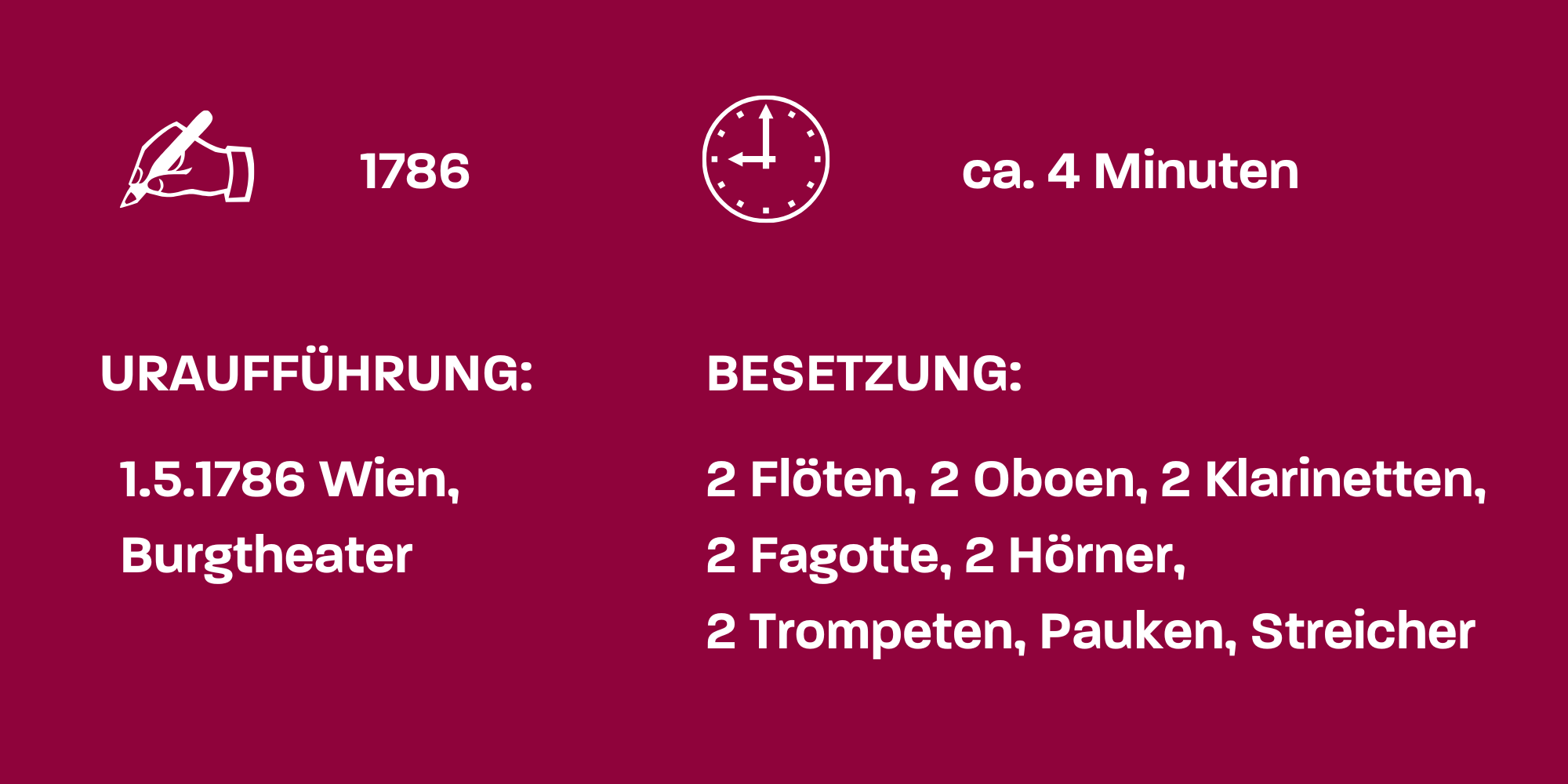
Die Uraufführung der neuen Oper „Le nozze di Figaro“ am 1.5.1786 im Wiener Burgtheater markiert die vielleicht wichtigste Zäsur der Wiener Jahre Mozarts. Am 29.4., zwei Tage vor der Premiere, hatte Mozart die vollendete Oper in sein Werkverzeichnis eingetragen, doch war die Komposition im Wesentlichen bereits in sechs Wochen des vorausgegangenen Herbstes vollzogen worden.
„Figaro“ war die erste Zusammenarbeit Mozarts mit dem findigen Librettisten Lorenzo da Ponte, der wohl auf Mozarts Vorschlag hin Beaumarchais‘ skandalträchtige Komödie zu einem Operntext nach den Bedürfnissen des Komponisten bearbeitete. Durch da Pontes Text und Mozarts Musik werden die einzelnen Personen zu lebendigen Charakteren ausgeformt, wobei die Musik bei diesem Charakterisierungsprozess die Hauptrolle übernimmt. Nicht allein in den Arien, sondern vor allem in den zahlreichen Ensembles bringt Mozart sein Gespür als Musikdramatiker voll zur Geltung.
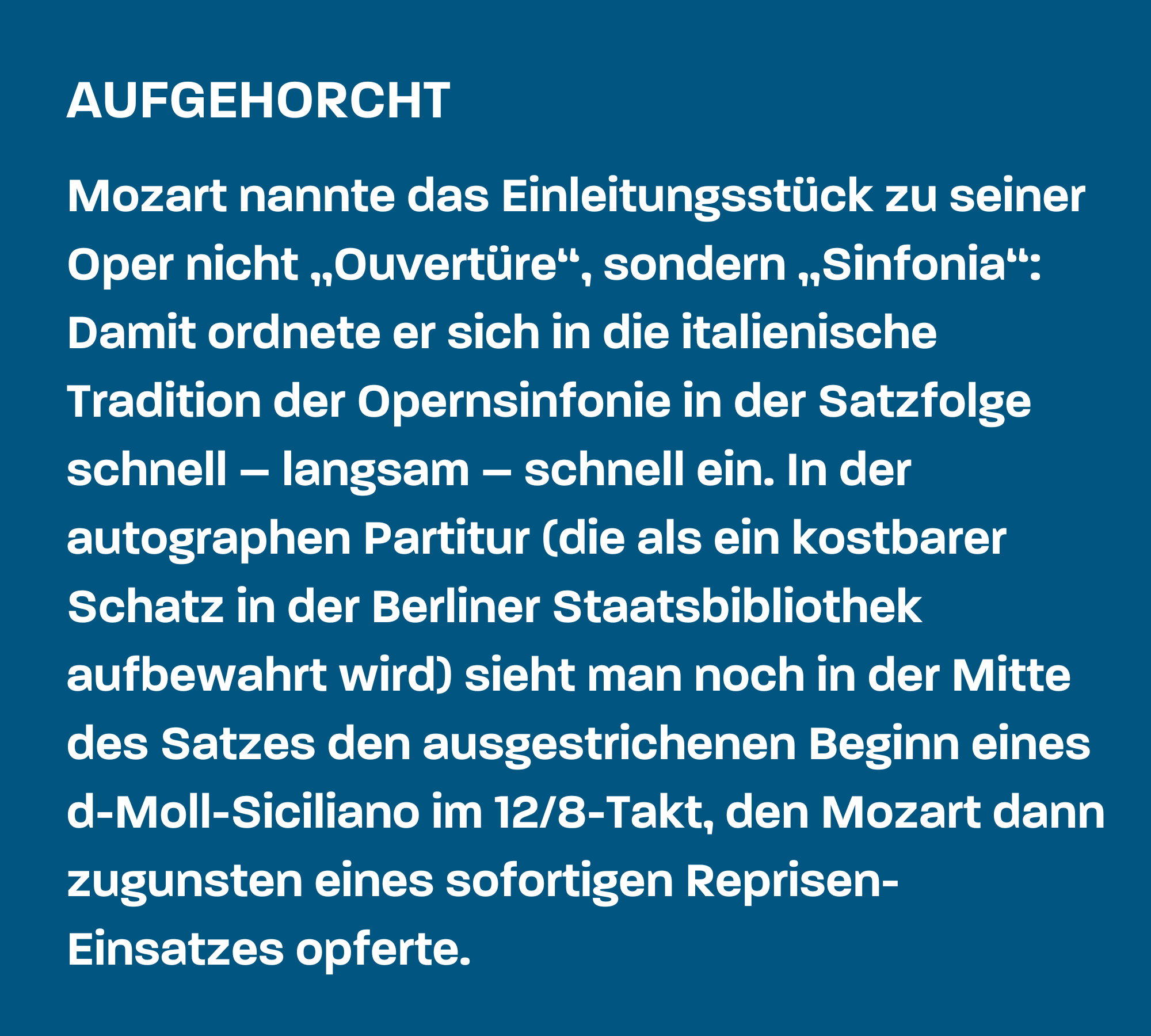
In einer Zeit, die noch keine Rundfunkübertragungen oder Schallplattenaufnahmen kannte, bildeten Bearbeitungen für Bläser- oder Kammerensemble (neben vierhändigen Klavierarrangements) ein wesentliches Medium, populäre Musik in Stadt und Land zu verbreiten – die Einrichtung der Ouvertüre dieser Oper für unsere Akademisten durch Felix Korinth, Bratscher im Konzerthausorchester Berlin, präsentiert diesen „Ohrwurm“ zunächst in einem klanglichen Gewand, wie er für die überwiegende Mehrheit der ersten Mozart-Fans damals vertrauter war als die Wiedergabe mit Sinfonieorchester. Nach und nach kommen dann jedoch die anderen Instrumentalstimmen hinzu, so dass der Schluss der Ouvertüre wieder in der originalen Besetzung, wie sie einst von Mozart erdacht worden war, erklingen wird.

Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67
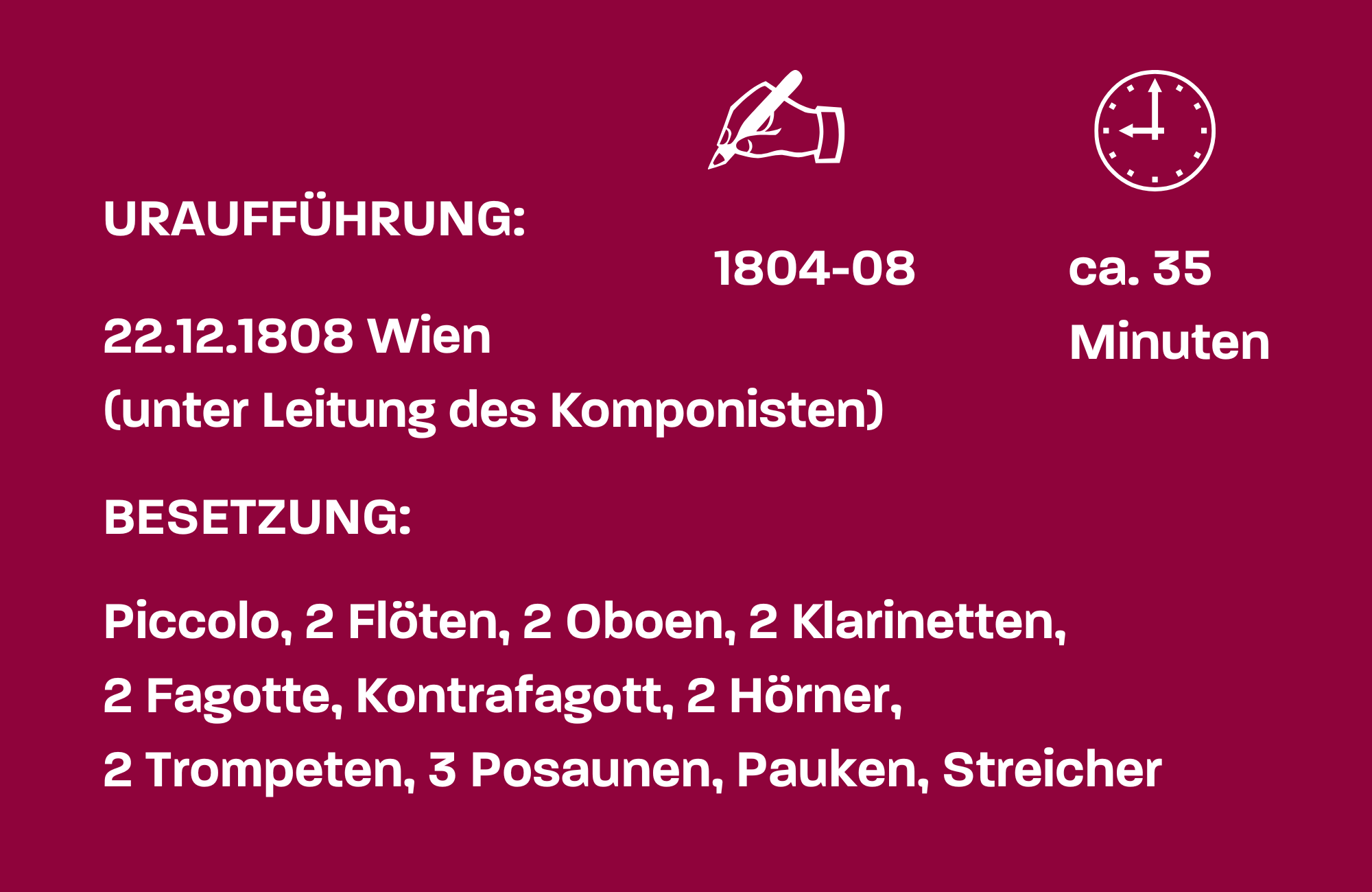
Die Sinfonie c-Moll beschäftigte Beethoven mindestens vier Jahre lang – so lange, dass sie bei der Uraufführung am 22.12.1808 in Wien als Nr. 6 gezählt worden war und erst später zur Drucklegung die Nummer mit der nach ihr konzipierten, aber bereits früher vollendeten Pastoral-Sinfonie tauschen musste. Sicherlich war Beethoven nicht von der Dramaturgie „Durch Nacht zum Licht“ oder der Bildlichkeit des „Schicksalsmotivs“, womit die Sinfonie anhebt, in Anspruch genommen worden, sondern von der Gesamtkonzeption einer überzeugenden und hörbaren motivisch-thematischen Einheitlichkeit auf der Grundlage einer „Keimzelle“, die eben jenes Schicksalsmotiv darstellen sollte. Auch die Erweiterung des orchestralen Aufgebots im Finale aus dem Arsenal der Militärmusik – Piccoloflöte und Kontrafagott, dazu drei Posaunen –, mit dem Beethoven das Erleben des Hörers aus dem Konzertsaal in die frische Luft französischer Revolutionsmusik entführt, war sicherlich nicht die Frucht einer spontanen Eingebung. Was so unmittelbar und eben spontan auf den Hörer wirkt, war das Ergebnis jahrelanger Entwürfe, Skizzen, Particell- und Partiturentwürfe, bis am Ende des Schaffensprozesses schließlich eine vollständige Partitur stand, die ein Kopist des Vertrauens schließlich in eine allgemein lesbare schriftliche Gestalt zu bringen hatte. Letzte Revisionen nahm der Komponist dann noch bei der Drucklegung vor. Doch selbst danach ist die Rezeptionsgeschichte dieser Sinfonie unabhängig von ihrer Berühmtheit von Lesefehlern und Missverständnissen geprägt (z. B. die Diskussion um eine ominöse Wiederholung im 3. Satz, wo der Komponist selbst zur Verwirrung der Nachwelt tüchtig beigetragen hatte ...).

Für die Mehrheit des Konzertpublikums bot Beethoven in dieser Akademie des Guten einfach zu viel, dazu musste man das überlange und zudem nicht ausreichend geprobte Programm in einem eisig kalten Saal absitzen, was die meisten – auch im Zusammenhang mit dem Erlebnis „moderner Musik“ – eher als eine Tortur denn als Genuss empfanden. So gehörte diese nachmals berühmte Akademie vom 22.12.1808 zu den „Sternstunden“ der Musikgeschichte, bei denen man nicht unbedingt dabei gewesen sein möchte, sondern sich der Jetztzeit mit ihren wohltemperierten Konzertsälen und Konzertprogrammen von meist bekömmlicher Länge erfreuen darf!
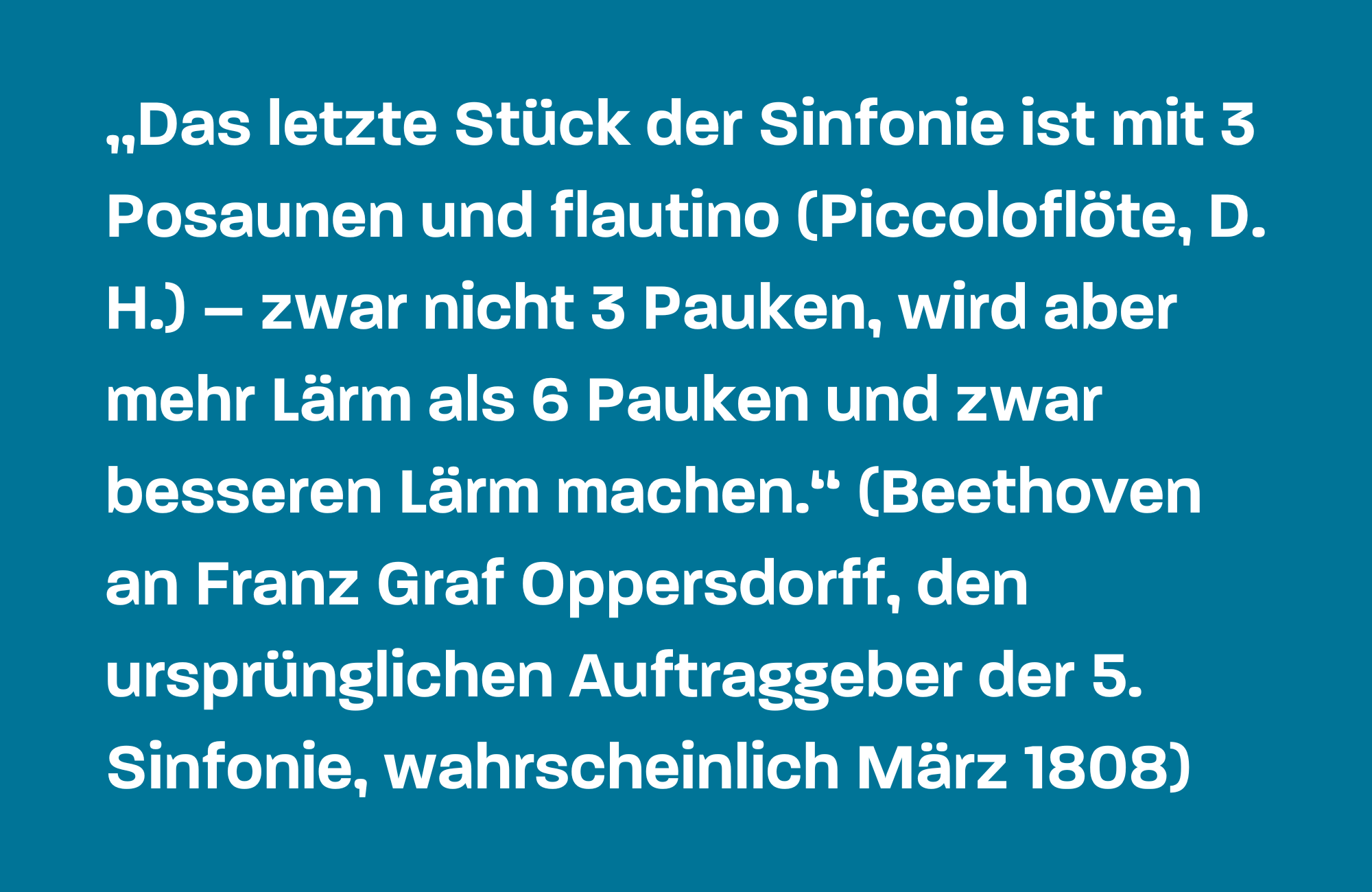
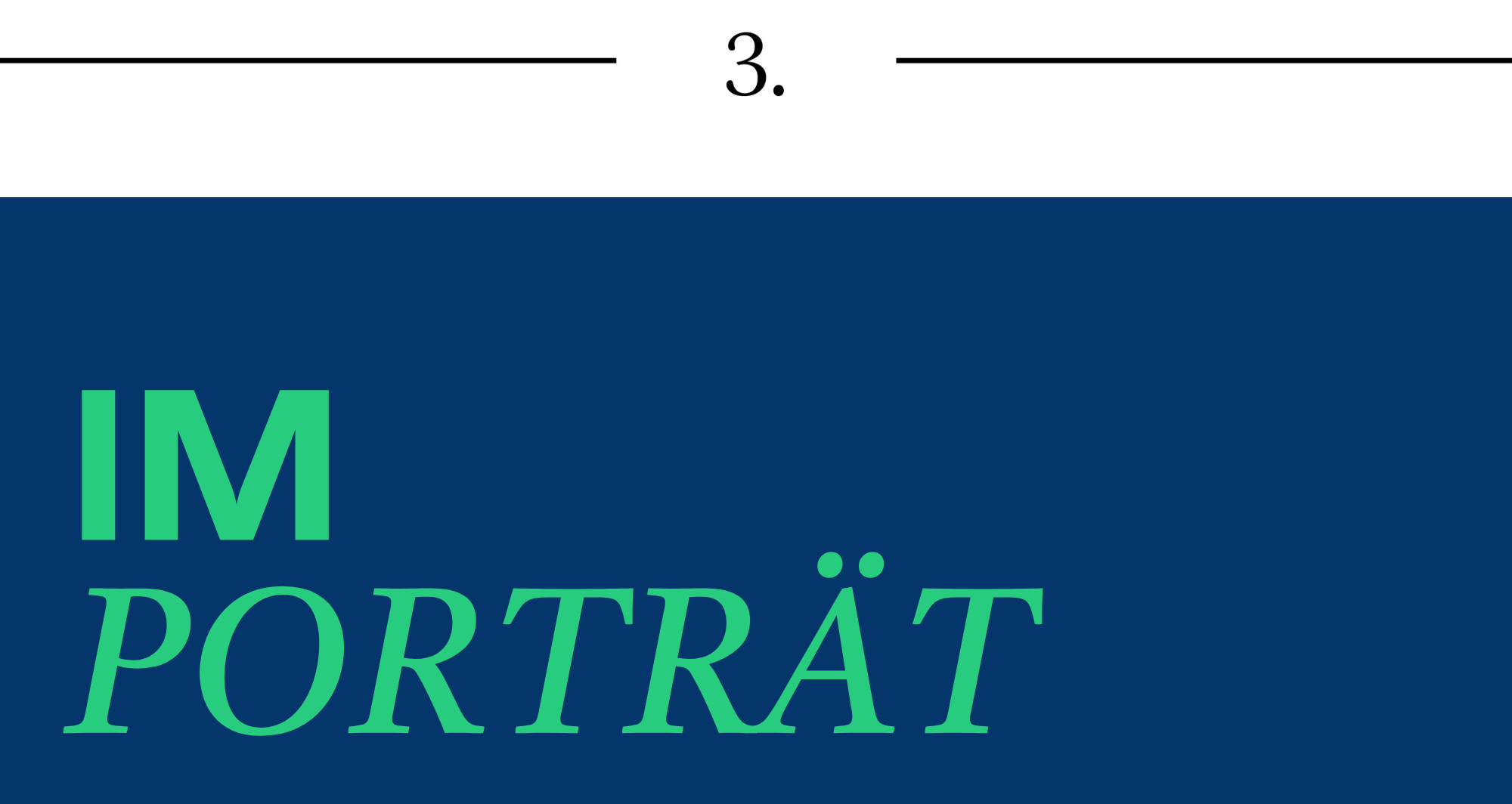


Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.
1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.
Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Seit der Saison 2023/24 ist Joana Mallwitz Chefdirigentin und Künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin.
Spätestens seit ihrem umjubelten Debüt bei den Salzburger Festspielen 2020 mit Mozarts „Cosi fan tutte“ zählt Joana Mallwitz zu den herausragenden Dirigent*innenpersönlichkeiten ihrer Generation. Ab 2018 als Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg tätig, wurde sie 2019 als „Dirigentin des Jahres“ ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren war sie an der Nationale Opera Amsterdam, dem Opera House Covent Garden, an der Bayerischen Staatsoper, der Oper Frankfurt, der Royal Danish Opera, der Norwegischen Nationaloper Oslo und der Oper Zürich zu Gast.
Konzertengagements führten sie zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, HR- und SWR-Sinfonieorchester, den Dresdner Philharmonikern, dem Philharmonia Orchestra London, den Münchner Philharmonikern, dem City of Birmingham Symphony Orchestra, dem Orchestre National de France, dem Orchestre de Paris und den Göteborger Symphonikern und als Porträtkünstlerin zum Wiener Musikverein.
Nach ihrem langjährigen Engagement als Kapellmeisterin am Theater Heidelberg trat Mallwitz zur Spielzeit 2014/2015 als jüngste Generalmusikdirektorin Europas ihr erstes Leitungsamt am Theater Erfurt an. Dort rief sie die Orchester-Akademie des Philharmonischen Orchesters ins Leben und begründete das Composer in Residence-Programm „Erfurts Neue Noten“. Ihre ebenfalls in dieser Zeit konzipierten „Expeditionskonzerte“ wurden auch am Staatstheater Nürnberg und als Online-Format ein durchschlagender Erfolg.
In Hildesheim geboren, studierte Joana Mallwitz an der Hochschule für Musik und Theater Hannover Dirigieren bei Martin Brauß und Eiji Oue sowie Klavier bei Karl-Heinz Kämmerling und Bernd Goetzke.
Joana Mallwitz ist Trägerin des Bayerischen Verfassungsordens und des Bundesverdienstkreuzes. Sie lebt mit Mann und Sohn in Berlin.
In ihrer Debütsaison 2023/24 nahm Joana Mallwitz mit dem Konzerthausorchester Berlin Werke von Kurt Weill auf. Sie erschienen vor kurzem bei Deutsche Grammophon, wo die Chefdirigentin Exklusivkünstlerin ist. Im Frühsommer 2024 kam „Momentum“, ein Dokumentarfilm von Günter Atteln über ihren Weg ans Konzerthaus Berlin, in die Kinos.
Veronika Kahrer wurde in Graz bei Anke Schittenhelm und in Feldkirch bei Rudens Turku ausgebildet und studiert nun bei Andreas Röhn in Hamburg. Orchestererfahrung hat die Geigerin unter anderem im European Union Youth Orchestra und als Akademistin bei den Symphonikern Hamburg gesammelt. Außerdem ist sie eine begeisterte Kammermusikerin. Ihr Stipendium wird von Berliner Volksbank AG unterstützt.
Flötist Giorgio Bani hat zunächst in Bergamo bei Paola Bonora studiert, aktuell ist er Masterstudent bei Andreas Mäder an der Hochschule für Künste Bremen. Orchestererfahrung hat er unter anderem als Mitglied der Akademie der Magdeburgischen Philharmonie gesammelt.
Bratscherin Sunghyun Jang stammt aus Südkorea und absolviert gerade ihr Bachelorstudium bei Yuta Nashiyama an der Berliner UdK. Sie ist Preisträgerin nationaler Wettbewerbe in ihrem Heimatland.
Fabian Sturm hat am Pariser Konservatorium bei Jérôme Pernoo sein Bachelor-Studium abgeschlossen, sein Masterstudium absolviert er in Hamburg bei Alexey Stadler. Der Berliner Cellist ist Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe und wurde zu zahlreichen Festivals eingeladen. Er ist Stipendiat der Deutschen Stiftung Musikleben, von „Live Music Now“ und der Studienstiftung des Deutschen Volkes.
In der Spielzeit 2024/2025 wird das Stipendium für die Kurt-Sanderling-Akademie vom Capital Club Berlin unterstützt.
Schlagzeuger Tigran Mirzoian aus St. Petersburg studiert in Rostock bei Henrik M. Schmidt, Jan-Frederick Behrend und Torsten Schönfeld. Orchestererfahrung hat er z.B. in der Staatskapelle St. Petersburg, am Mariinski Theater, im DSO und als Praktikant am Staatstheater Braunschweig gesammelt. Tigran ist Gewinner des Yamaha-Stipendienwettbewerbs für Konzertpercussion.
Bratscher Felix Korinth studierte in seiner Heimatstadt Berlin an der Hochschule für Musik Hanns Eisler bei Gerhard Riedel. Seit 2005 ist er Mitglied im Konzerthausorchester Berlin, außerdem spielt er im Konzerthaus Kammerorchester. Der passionierte Kammermusiker tritt regelmäßig in verschiedenen Besetzungen auf. Als Akademiebeauftragter betreut Felix Korinth die Stipendiat*innen der Kurt-Sanderling-Akademie des Konzerthausorchesters.